Projektarchiv:In Zukunft mit UNS!: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Hintergrund und Zielsetzung des | == Hintergrund und Zielsetzung des Projekts == | ||
„In Zukunft mit UNS!“ war ein Projekt der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH und wurde vom Landesjugendring Baden-Württemberg in Abstimmung mit der Landeszentrale für politische Bildung durchgeführt. Ziel war es, Jugendliche zu befähigen, sich aktiv für eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen und für mehr Demokratie in ihrem Lebensumfeld einzusetzen. Zusätzlich wurden im Laufe des Projekts auch erwachsene Mitarbeitende der Verwaltung als Zielgruppe einbezogen: Jugendbeteiligung ist eine Querschnittsaufgabe in der Verwaltung. Auch fähige Jugendliche können im kommunalen Umfeld nicht viel erreichen, wenn die Gemeinde nicht ebenfalls von der Wichtigkeit der Jugendbeteiligung überzeugt ist, nicht wesentliche Methoden und Verfahren kennt und sich nicht über grundsätzliche rechtliche Rahmenbedingungen bewusst ist. Aus diesem Gedanken ist weiterhin das Qualifizierungsangebot „Aktivierende Jugendbeteiligung“ entstanden. | „In Zukunft mit UNS!“ war ein Projekt der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH und wurde vom Landesjugendring Baden-Württemberg in Abstimmung mit der Landeszentrale für politische Bildung durchgeführt. Ziel war es, Jugendliche zu befähigen, sich aktiv für eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen und für mehr Demokratie in ihrem Lebensumfeld einzusetzen. Zusätzlich wurden im Laufe des Projekts auch erwachsene Mitarbeitende der Verwaltung als Zielgruppe einbezogen: Jugendbeteiligung ist eine Querschnittsaufgabe in der Verwaltung. Auch fähige Jugendliche können im kommunalen Umfeld nicht viel erreichen, wenn die Gemeinde nicht ebenfalls von der Wichtigkeit der Jugendbeteiligung überzeugt ist, nicht wesentliche Methoden und Verfahren kennt und sich nicht über grundsätzliche rechtliche Rahmenbedingungen bewusst ist. Aus diesem Gedanken ist weiterhin das Qualifizierungsangebot „Aktivierende Jugendbeteiligung“ entstanden. | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Formal gliederte sich das Projekt in zwei Phasen: | Formal gliederte sich das Projekt in zwei Phasen: | ||
* Phase I: In Zukunft mit UNS! ‒ Wahl ab 16 (bei den Kommunalwahlen 2014) | * Phase I: In Zukunft mit UNS! ‒ Wahl ab 16 (bei den Kommunalwahlen 2014) | ||
* Phase II: In Zukunft mit UNS! ‒ Qualifizierung Jugendlicher in Beteiligungsprozessen | * Phase II: In Zukunft mit UNS! ‒ Qualifizierung Jugendlicher in Beteiligungsprozessen | ||
== Projektphase 1: Wahl ab 16 == | == Projektphase 1: Wahl ab 16 == | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
Am 20.02.2014 ging das Bündnis „Wählen ab 16“ mit einer Landespressekonferenz (LPK) an die Öffentlichkeit. Verbunden hiermit waren die gleichzeitige Freischaltung der Bündniswebsite, die Veröffentlichung des Angebotskatalogs des Bündnisses (online und als gedruckte Broschüre) sowie die Möglichkeit, online Aktionstage des Projekts „In Zukunft mit UNS!“ zu buchen. | Am 20.02.2014 ging das Bündnis „Wählen ab 16“ mit einer Landespressekonferenz (LPK) an die Öffentlichkeit. Verbunden hiermit waren die gleichzeitige Freischaltung der Bündniswebsite, die Veröffentlichung des Angebotskatalogs des Bündnisses (online und als gedruckte Broschüre) sowie die Möglichkeit, online Aktionstage des Projekts „In Zukunft mit UNS!“ zu buchen. | ||
==== Angebotskatalog und Homepage ==== | |||
Der Angebotskatalog des Bündnisses erschien als DIN lang-Broschüre. In dieser wurden die Initiatoren des Bündnisses – die LpB und der LJR – sowie die Baden-Württemberg Stiftung als Trägerin des größten Einzelbeitrags vorgestellt. Alle weiteren Bündnispartner wurden aufgelistet. Die auf Aktionstage bezogenen Angebote aus dem Projekt „In Zukunft mit UNS!“ wurden auf drei Seiten ausführlich vorgestellt (Angebotsnummern 101–106). | Der Angebotskatalog des Bündnisses erschien als DIN lang-Broschüre. In dieser wurden die Initiatoren des Bündnisses – die LpB und der LJR – sowie die Baden-Württemberg Stiftung als Trägerin des größten Einzelbeitrags vorgestellt. Alle weiteren Bündnispartner wurden aufgelistet. Die auf Aktionstage bezogenen Angebote aus dem Projekt „In Zukunft mit UNS!“ wurden auf drei Seiten ausführlich vorgestellt (Angebotsnummern 101–106). | ||
Auf der Bündnishomepage http://waehlenab16-bw.de wurden analog zum Angebotskatalog die Angebote aller Bündnispartner vorgestellt – diese konnten direkt online angefragt oder gebucht werden. Die Anmeldungen zu Aktionstagen des Projekts „In Zukunft mit UNS!“ wurden per E-Mail an die Projektfachstelle weitergeleitet. Materialien der Bündnispartner konnten als PDF-Dateien heruntergeladen werden, so auch die Handreichung 1 und die Arbeitsmaterialien aus dem Projekt „In Zukunft mit UNS! . Darüber hinaus gab es textlich und audiovisuell aufbereitete Hilfen zum Thema „Wählen ab 16“, Testimonials, ein Erklärvideo und Social Media-Verknüpfungen. Auch die Online-Wahlsimulation des Projekts „In Zukunft mit UNS!“ wurde auf dem Server des Bündnisangebots „gehostet“ und auf der Startseite der Bündnishomepage verlinkt. | Auf der Bündnishomepage http://waehlenab16-bw.de wurden analog zum Angebotskatalog die Angebote aller Bündnispartner vorgestellt – diese konnten direkt online angefragt oder gebucht werden. Die Anmeldungen zu Aktionstagen des Projekts „In Zukunft mit UNS!“ wurden per E-Mail an die Projektfachstelle weitergeleitet. Materialien der Bündnispartner konnten als PDF-Dateien heruntergeladen werden, so auch die Handreichung 1 und die Arbeitsmaterialien aus dem Projekt „In Zukunft mit UNS! . Darüber hinaus gab es textlich und audiovisuell aufbereitete Hilfen zum Thema „Wählen ab 16“, Testimonials, ein Erklärvideo und Social Media-Verknüpfungen. Auch die Online-Wahlsimulation des Projekts „In Zukunft mit UNS!“ wurde auf dem Server des Bündnisangebots „gehostet“ und auf der Startseite der Bündnishomepage verlinkt. | ||
==== Werbung für Aktionstage im Rahmen kommunaler Bündnisse ==== | |||
Ein wichtiger Tätigkeitsbereich insbesondere von Oktober 2013 bis Februar 2014 war die Werbung zur Gründung kommunaler Bündnisse. | Ein wichtiger Tätigkeitsbereich insbesondere von Oktober 2013 bis Februar 2014 war die Werbung zur Gründung kommunaler Bündnisse. | ||
=== Gewinnung und Qualifizierung von Multiplikator*innen === | === Gewinnung und Qualifizierung von Multiplikator*innen === | ||
==== Die Schulungen ==== | |||
Insgesamt wurden fünf Multiplikator*innen-Schulungen durchgeführt: | Insgesamt wurden fünf Multiplikator*innen-Schulungen durchgeführt: | ||
* 20./21.12.2013 in Bad Liebenzell: 45 Teilnehmende mit Vorerfahrung aus allen Regierungsbezirken. Konzentration auf Großgruppenmoderationsmethoden. | * 20./21.12.2013 in Bad Liebenzell: 45 Teilnehmende mit Vorerfahrung aus allen Regierungsbezirken. Konzentration auf Großgruppenmoderationsmethoden. | ||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
Grundsätzlich waren die Teilnehmenden sehr zufrieden mit den Schulungen. Mehrfach kritisch angemerkt wurde der lange Leerlauf zwischen den Schulungen (insbesondere derjenigen in Bad Liebenzell im Dezember 2013) und der heißen Phase der Aktionstage. | Grundsätzlich waren die Teilnehmenden sehr zufrieden mit den Schulungen. Mehrfach kritisch angemerkt wurde der lange Leerlauf zwischen den Schulungen (insbesondere derjenigen in Bad Liebenzell im Dezember 2013) und der heißen Phase der Aktionstage. | ||
==== Handreichung Nr. 1: Methodenhandbuch und Arbeitsmaterialien für Multiplikatorinnen und Interessierte ==== | |||
Das Methodenhandbuch folgt im Wesentlichen dem Aufbau der Schulungen und damit auch dem der Aktionstage. Den Schwerpunkt bilden Kurzbeschreibungen aller vorgestellten Methoden. Vorangestellt sind jeweils Angaben zur Zielgruppe, zur idealen Teilnehmendenzahl, zu benötigtem Material, zu Bedingungen an die Räumlichkeiten, zum Schwierigkeitsgrad der Methode und zu deren didaktischem Hauptziel. Zu den meisten Methoden gehören umfangreiche Arbeitsmaterialien (insgesamt ca. 270 Seiten), die noch [https://www.ljrbw.de/files/downloads/In%20Zukunft%20mit%20UNS%21/IZmU_Methodensammlung_komplett.zip beim Landesjugendring] abgerufen werden können. | Das Methodenhandbuch folgt im Wesentlichen dem Aufbau der Schulungen und damit auch dem der Aktionstage. Den Schwerpunkt bilden Kurzbeschreibungen aller vorgestellten Methoden. Vorangestellt sind jeweils Angaben zur Zielgruppe, zur idealen Teilnehmendenzahl, zu benötigtem Material, zu Bedingungen an die Räumlichkeiten, zum Schwierigkeitsgrad der Methode und zu deren didaktischem Hauptziel. Zu den meisten Methoden gehören umfangreiche Arbeitsmaterialien (insgesamt ca. 270 Seiten), die noch [https://www.ljrbw.de/files/downloads/In%20Zukunft%20mit%20UNS%21/IZmU_Methodensammlung_komplett.zip beim Landesjugendring] abgerufen werden können. | ||
Das Methodenhandbuch „In Zukunft mit UNS! Wahl ab 16“ kann beim Landesjugendring heruntergeladen werden: [https://www.ljrbw.de/publikationen/in-zukunft-mit-uns-wahl-ab-16 https://www.ljrbw.de/publikationen/in-zukunft-mit-uns-wahl-ab-16] | Das Methodenhandbuch „In Zukunft mit UNS! Wahl ab 16“ kann beim Landesjugendring heruntergeladen werden: [https://www.ljrbw.de/publikationen/in-zukunft-mit-uns-wahl-ab-16 https://www.ljrbw.de/publikationen/in-zukunft-mit-uns-wahl-ab-16] | ||
| Zeile 83: | Zeile 83: | ||
Neben der Durchführung von Schulungen traten die Erstellung von geeigneten Sensibilisierungsmodulen für die drei Orte der Jugendbeteiligung, die dafür notwendige Recherchearbeit, die Aufbereitung der Ergebnisse in drei weiteren Arbeitshilfen sowie in einem letzten Schritt die Pilotierung und weitere Durchführung der Angebote zum Gewinn von Erfahrungen in den Vordergrund der Projektmaßnahmen. | Neben der Durchführung von Schulungen traten die Erstellung von geeigneten Sensibilisierungsmodulen für die drei Orte der Jugendbeteiligung, die dafür notwendige Recherchearbeit, die Aufbereitung der Ergebnisse in drei weiteren Arbeitshilfen sowie in einem letzten Schritt die Pilotierung und weitere Durchführung der Angebote zum Gewinn von Erfahrungen in den Vordergrund der Projektmaßnahmen. | ||
==== erfahrene Multiplikator*innen erarbeiten drei Handreichungen und Schulungsmodule ==== | |||
Für die Recherche sowie für die Ausarbeitung der Module und deren Verschriftlichung in den Arbeitshilfen hat die Projektfachstelle im August und September 2014 ein Team von 11 Multiplikator*innen („Multis“) zusammengestellt. Als Auswahlkriterium diente eine Kurzbewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und verbindlichen Aussagen zum bis März 2015 für das Projekt zur Verfügung stehenden Zeitbudget. Alle 11 Multis waren bereits in der ersten Projektphase im Einsatz. Sie wurden per Werkvertrag in das Projekt eingebunden und teilten sich entsprechend der Zielgruppen „Schule“, „Kommunen“ und „Vereine & Verbände“ in drei Arbeitsgruppen auf. | Für die Recherche sowie für die Ausarbeitung der Module und deren Verschriftlichung in den Arbeitshilfen hat die Projektfachstelle im August und September 2014 ein Team von 11 Multiplikator*innen („Multis“) zusammengestellt. Als Auswahlkriterium diente eine Kurzbewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und verbindlichen Aussagen zum bis März 2015 für das Projekt zur Verfügung stehenden Zeitbudget. Alle 11 Multis waren bereits in der ersten Projektphase im Einsatz. Sie wurden per Werkvertrag in das Projekt eingebunden und teilten sich entsprechend der Zielgruppen „Schule“, „Kommunen“ und „Vereine & Verbände“ in drei Arbeitsgruppen auf. | ||
Die Arbeitsgruppen „Jugendgruppe“ und „Kommune“ planten jeweils eine Handreichung sowie ein dazugehörendes Workshop-Angebot. Die Arbeitsgruppe „Schule“ blieb zunächst bei einer Handreichung, da für diese erheblich mehr Vorabrecherche zu leisten war. Die Weiterbearbeitung der Ergebnisse zu einem Workshop-Modul erfolgte im Herbst 2015. Hier blieb es bei einer Pilotdurchführung. Die Arbeit der Multis erfolgte in allen drei Gruppen innerhalb eines durch die Projektfachstelle vorgegebenen Rahmens so frei wie möglich. Ein Abgleich zwischen den Ideen der Multis und den für die Projektfachstelle verbindlichen Projektzielen erfolgte durch wöchentliche Telefonkonferenzen der drei Gruppen sowie durch drei gemeinsame Wochenend-Workshops. | Die Arbeitsgruppen „Jugendgruppe“ und „Kommune“ planten jeweils eine Handreichung sowie ein dazugehörendes Workshop-Angebot. Die Arbeitsgruppe „Schule“ blieb zunächst bei einer Handreichung, da für diese erheblich mehr Vorabrecherche zu leisten war. Die Weiterbearbeitung der Ergebnisse zu einem Workshop-Modul erfolgte im Herbst 2015. Hier blieb es bei einer Pilotdurchführung. Die Arbeit der Multis erfolgte in allen drei Gruppen innerhalb eines durch die Projektfachstelle vorgegebenen Rahmens so frei wie möglich. Ein Abgleich zwischen den Ideen der Multis und den für die Projektfachstelle verbindlichen Projektzielen erfolgte durch wöchentliche Telefonkonferenzen der drei Gruppen sowie durch drei gemeinsame Wochenend-Workshops. | ||
==== Workshops zur Konzepterstellung ==== | |||
Das konkrete Vorgehen wurde in drei Workshops vom 16.‒17.10.2014 in Rottenburg, vom 31.10.‒02.11.2014 in Rastatt sowie vom 16.‒18.01.2015 in Bad Herrenalb detailliert geplant. In Rottenburg wurde gemeinsam mit Vertreter*innen das Grobkonzept erarbeitet. In Rastatt wurde bis zur Zuweisung von Detailaufgaben auf die beteiligten Multis und der Aufstellung eines genauen Zeitplans das gemeinsame Projektmanagement besprochen. In Bad Herrenalb wurden die Zwischenergebnisse zusammengetragen, in der gemeinsamen Diskussion auf Durchführbarkeit und Konsistenz geprüft und die Broschüren bis auf Absatzebene feingegliedert. | Das konkrete Vorgehen wurde in drei Workshops vom 16.‒17.10.2014 in Rottenburg, vom 31.10.‒02.11.2014 in Rastatt sowie vom 16.‒18.01.2015 in Bad Herrenalb detailliert geplant. In Rottenburg wurde gemeinsam mit Vertreter*innen das Grobkonzept erarbeitet. In Rastatt wurde bis zur Zuweisung von Detailaufgaben auf die beteiligten Multis und der Aufstellung eines genauen Zeitplans das gemeinsame Projektmanagement besprochen. In Bad Herrenalb wurden die Zwischenergebnisse zusammengetragen, in der gemeinsamen Diskussion auf Durchführbarkeit und Konsistenz geprüft und die Broschüren bis auf Absatzebene feingegliedert. | ||
| Zeile 95: | Zeile 95: | ||
Das Ziel der vierköpfigen Arbeitsgruppe „Jugendbeteiligung in der Kommune“ und der Projektfachstelle war die Aufbereitung von praxisrelevanten Informationen in einer Handreichung sowie die parallele Erarbeitung eines Sensibilisierungsmoduls für am Thema interessierte Jugendliche in der Kommune. | Das Ziel der vierköpfigen Arbeitsgruppe „Jugendbeteiligung in der Kommune“ und der Projektfachstelle war die Aufbereitung von praxisrelevanten Informationen in einer Handreichung sowie die parallele Erarbeitung eines Sensibilisierungsmoduls für am Thema interessierte Jugendliche in der Kommune. | ||
==== Handreichung Nr. 2: „Jugendbeteiligung in der Kommunen ==== | |||
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe wurden im April 2015 als Handreichung Nr. 2 „Jugendbeteiligung in der Kommune“ veröffentlicht. Die Broschüre richtet sich an Mitarbeitende der Verwaltung sowie an Auszubildende, die in einer Art Brückenfunktion bestimmte Aufgaben im Themenfeld „Jugendbeteiligung“ in der Kommune wahrnehmen können. Die Handreichung gliedert sich in drei Hauptkapitel: | Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe wurden im April 2015 als Handreichung Nr. 2 „Jugendbeteiligung in der Kommune“ veröffentlicht. Die Broschüre richtet sich an Mitarbeitende der Verwaltung sowie an Auszubildende, die in einer Art Brückenfunktion bestimmte Aufgaben im Themenfeld „Jugendbeteiligung“ in der Kommune wahrnehmen können. Die Handreichung gliedert sich in drei Hauptkapitel: | ||
* Zunächst werden den Aktiven vor Ort in einem Kapitel „Wozu Jugendbeteiligung?“ Argumente an die Hand gegeben, die dafür sprechen, sich vor Ort für eine lebendige Jugendbeteiligungskultur einzusetzen. Diese sollten insbesondere als Hilfestellung dienen, um das Thema gegenüber der Politik vor Ort stark zu machen. | * Zunächst werden den Aktiven vor Ort in einem Kapitel „Wozu Jugendbeteiligung?“ Argumente an die Hand gegeben, die dafür sprechen, sich vor Ort für eine lebendige Jugendbeteiligungskultur einzusetzen. Diese sollten insbesondere als Hilfestellung dienen, um das Thema gegenüber der Politik vor Ort stark zu machen. | ||
| Zeile 103: | Zeile 103: | ||
Die Handreichung kann im [https://www.ljrbw.de/publikationen/in-zukunft-mit-uns-jugendbeteiligung-in-der-kommune Onlineshop des Landesjugendrings] heruntergeladen werden. | Die Handreichung kann im [https://www.ljrbw.de/publikationen/in-zukunft-mit-uns-jugendbeteiligung-in-der-kommune Onlineshop des Landesjugendrings] heruntergeladen werden. | ||
==== Workshopmodul und Arbeitsmaterialien „Das Heft in der Hand“ ==== | |||
Parallel zur Handreichung Nr. 2 entstand das Workshopmodul. Zielgruppe waren Auszubildende in den Verwaltungen und weitere in der Kommune aktive Jugendliche. Ziel war es, diese für das Thema Jugendbeteiligung zu sensibilisieren und dafür zu qualifizieren, sich selbst vor Ort in einer Weise einzubringen, die es wiederum anderen Jugendlichen leichter macht, sich vor Ort für ihre eigenen Belange einzusetzen. | Parallel zur Handreichung Nr. 2 entstand das Workshopmodul. Zielgruppe waren Auszubildende in den Verwaltungen und weitere in der Kommune aktive Jugendliche. Ziel war es, diese für das Thema Jugendbeteiligung zu sensibilisieren und dafür zu qualifizieren, sich selbst vor Ort in einer Weise einzubringen, die es wiederum anderen Jugendlichen leichter macht, sich vor Ort für ihre eigenen Belange einzusetzen. | ||
Der Aufbau ähnelte dem der Handreichung Nr. 2. Argumente für Jugendbeteiligung sollten gemeinsam mit den Jugendlichen erarbeitet werden. Eine Beschäftigung mit verschiedenen Modellen der Jugendbeteiligung erfolgte zunächst in Gruppenarbeit, vertiefend dann in Rollenspielen, in denen einzelne Methoden in Kurzform simuliert wurden. Die Systematisierung erfolgte im Plenum, ebenso wie die Erarbeitung von Gelingensfaktoren und Umsetzungsideen. | Der Aufbau ähnelte dem der Handreichung Nr. 2. Argumente für Jugendbeteiligung sollten gemeinsam mit den Jugendlichen erarbeitet werden. Eine Beschäftigung mit verschiedenen Modellen der Jugendbeteiligung erfolgte zunächst in Gruppenarbeit, vertiefend dann in Rollenspielen, in denen einzelne Methoden in Kurzform simuliert wurden. Die Systematisierung erfolgte im Plenum, ebenso wie die Erarbeitung von Gelingensfaktoren und Umsetzungsideen. | ||
| Zeile 113: | Zeile 113: | ||
* 02.04.2016 in Ulm: Die Teilnehmenden waren Jugendliche des Jugendparlaments (JuPa) Ulm. Ziel war es, mit den Jugendlichen zusammen zu erarbeiten, was diese mit dem JuPa in der nahen und ferneren Zukunft erreichen wollen bzw. wie sie sich ihre eigene Arbeit vorstellen und wie sie das JuPa organisieren möchten. Bei diesem Workshop durfte also von einer hohen Motivation der Teilnehmenden ausgegangen werden. Die 17 Jugendlichen waren mit dem Workshop sehr zufrieden. Ein Ergebnis war die Idee, die Arbeit des JuPas weiter zu öffnen und auch offenere Formate der Jugendbeteiligung zu unterstützen. | * 02.04.2016 in Ulm: Die Teilnehmenden waren Jugendliche des Jugendparlaments (JuPa) Ulm. Ziel war es, mit den Jugendlichen zusammen zu erarbeiten, was diese mit dem JuPa in der nahen und ferneren Zukunft erreichen wollen bzw. wie sie sich ihre eigene Arbeit vorstellen und wie sie das JuPa organisieren möchten. Bei diesem Workshop durfte also von einer hohen Motivation der Teilnehmenden ausgegangen werden. Die 17 Jugendlichen waren mit dem Workshop sehr zufrieden. Ein Ergebnis war die Idee, die Arbeit des JuPas weiter zu öffnen und auch offenere Formate der Jugendbeteiligung zu unterstützen. | ||
==== Workshopreihe „Aktivierende Jugendbeteiligung“ ==== | |||
Ein zweitägiger und vier eintägige Workshops fanden in Kooperation mit der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl statt. Der zweitägige Workshop fand zusätzlich noch in Kooperation mit der Führungsakademie Baden-Württemberg statt. Alle fünf Workshops richteten sich an Mitarbeitende aus allen Verwaltungsbereichen wie z. B. Hauptämter, Jugendreferate, Fachstellen für Bürgerengagement usw. | Ein zweitägiger und vier eintägige Workshops fanden in Kooperation mit der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl statt. Der zweitägige Workshop fand zusätzlich noch in Kooperation mit der Führungsakademie Baden-Württemberg statt. Alle fünf Workshops richteten sich an Mitarbeitende aus allen Verwaltungsbereichen wie z. B. Hauptämter, Jugendreferate, Fachstellen für Bürgerengagement usw. | ||
| Zeile 163: | Zeile 163: | ||
Die Juleica ist ein bundesweit anerkanntes Zertifikat für Jugendgruppenleiter*innen. Darüber hinaus besteht die Selbstverpflichtung von Vereinen und Verbänden in Baden-Württemberg, bei der Ausbildung der Jugendgruppenleiter*innen bestimmte Standards einzuhalten. U. a. ist geregelt, dass diese Ausbildung für die ehrenamtlichen Jugendgruppenleiter*innen mindestens 40 Einheiten à 40 Minuten enthält, was meistens einem einwöchigen Seminar entspricht. 22 dieser Einheiten sind fest gesetzt, z. B. durch rechtliche Grundlagen. 18 Einheiten aus drei unterschiedlichen Bausteinen können entlang eines vom Verband jeweils frei wählbaren Themas gestaltet werden. | Die Juleica ist ein bundesweit anerkanntes Zertifikat für Jugendgruppenleiter*innen. Darüber hinaus besteht die Selbstverpflichtung von Vereinen und Verbänden in Baden-Württemberg, bei der Ausbildung der Jugendgruppenleiter*innen bestimmte Standards einzuhalten. U. a. ist geregelt, dass diese Ausbildung für die ehrenamtlichen Jugendgruppenleiter*innen mindestens 40 Einheiten à 40 Minuten enthält, was meistens einem einwöchigen Seminar entspricht. 22 dieser Einheiten sind fest gesetzt, z. B. durch rechtliche Grundlagen. 18 Einheiten aus drei unterschiedlichen Bausteinen können entlang eines vom Verband jeweils frei wählbaren Themas gestaltet werden. | ||
==== Handreichung Nr. 3: „Selbstbestimmt! Beteiligung in der Jugendgruppe leben“ ==== | |||
Die Handreichung folgt der unten skizzierten Logik des Workshopmoduls und ist als Methodensammlung mit ergänzenden Inhalten konzipiert. Sie beschäftigt sich mit Konzepten der Beteiligungsförderung auf fünf hierarchischen, jedoch miteinander verschränkten, Bezugsebenen: | Die Handreichung folgt der unten skizzierten Logik des Workshopmoduls und ist als Methodensammlung mit ergänzenden Inhalten konzipiert. Sie beschäftigt sich mit Konzepten der Beteiligungsförderung auf fünf hierarchischen, jedoch miteinander verschränkten, Bezugsebenen: | ||
* Persönliche und zwischenmenschliche Ebene (Kapitel „Beteiligung leben!“): Beteiligung ‒ was hat das mit mir zu tun? Was ist Beteiligung überhaupt? Welche Stufen der Beteiligung gibt es und wie finde ich meinen normativen Standpunkt, wie viel Beteiligung ich wann zulasse? | * Persönliche und zwischenmenschliche Ebene (Kapitel „Beteiligung leben!“): Beteiligung ‒ was hat das mit mir zu tun? Was ist Beteiligung überhaupt? Welche Stufen der Beteiligung gibt es und wie finde ich meinen normativen Standpunkt, wie viel Beteiligung ich wann zulasse? | ||
| Zeile 173: | Zeile 173: | ||
Die Handreichung kann im [https://www.ljrbw.de/publikationen/in-zukunft-mit-uns-selbstbestimmt Onlineshop des Landesjugendrings] heruntergeladen werden. | Die Handreichung kann im [https://www.ljrbw.de/publikationen/in-zukunft-mit-uns-selbstbestimmt Onlineshop des Landesjugendrings] heruntergeladen werden. | ||
==== Workshopmodul und Arbeitsmaterialien „Selbstbestimmt! Beteiligung in der Jugendgruppe leben“ ==== | |||
Das Modul wurde nach dem Baukastenprinzip gestaltet, um den Wünschen und Zielen der auftraggebenden Organisation entgegenzukommen. Variabel ist das Modul auch hinsichtlich der Länge: Es konnte ein kompletter Tag gebucht werden, z. B. als Juleica-Auffrischungsseminar, oder ein mehrstündiges Modul, welches als Baustein in die normale Juleica-Schulung integriert werden kann: von kurzen Einführungen zur Frage „Was heißt Beteiligung überhaupt und was heißt es, Beteiligung zu leben?“, bis hin zu Workshops mit dem Ziel, ein gemeinsames Vorgehen zur Öffnung hin zu mehr Beteiligung zu verabreden. | Das Modul wurde nach dem Baukastenprinzip gestaltet, um den Wünschen und Zielen der auftraggebenden Organisation entgegenzukommen. Variabel ist das Modul auch hinsichtlich der Länge: Es konnte ein kompletter Tag gebucht werden, z. B. als Juleica-Auffrischungsseminar, oder ein mehrstündiges Modul, welches als Baustein in die normale Juleica-Schulung integriert werden kann: von kurzen Einführungen zur Frage „Was heißt Beteiligung überhaupt und was heißt es, Beteiligung zu leben?“, bis hin zu Workshops mit dem Ziel, ein gemeinsames Vorgehen zur Öffnung hin zu mehr Beteiligung zu verabreden. | ||
| Zeile 195: | Zeile 195: | ||
=== Jugendbeteiligung in der Schule === | === Jugendbeteiligung in der Schule === | ||
==== Handreichung Nr. 4: „Die Drittelparität in der Schulkonferenz. Erste Auswirkungen des neuen Schulgesetzes in Baden-Württemberg“ ==== | |||
Im Bereich Schule befand sich vieles im Umbruch, besonders zu Beginn der zweiten Projektphase. Im Gegensatz zu den beiden o. g. Orten der Beteiligung erschien die Erarbeitung eines fertigen Moduls sowie einer Methoden- oder Ratgeberhandreichung zur Jugendbeteiligung in Schulen zum Zeitpunkt der Projektkonzeption als verfrüht; Die beteiligungskulturellen Auswirkungen der vielen gesetzlichen Änderungen waren nicht absehbar und hätten daher in einem solchen Konzept nicht berücksichtigt werden können. Hinzu kam, dass die für ein solches Modul notwendigen Vereinbarungen mit dem Kultusministerium in der Kürze der Projektlaufzeit nicht ausreichend detailliert hätten vorgenommen werden können. | Im Bereich Schule befand sich vieles im Umbruch, besonders zu Beginn der zweiten Projektphase. Im Gegensatz zu den beiden o. g. Orten der Beteiligung erschien die Erarbeitung eines fertigen Moduls sowie einer Methoden- oder Ratgeberhandreichung zur Jugendbeteiligung in Schulen zum Zeitpunkt der Projektkonzeption als verfrüht; Die beteiligungskulturellen Auswirkungen der vielen gesetzlichen Änderungen waren nicht absehbar und hätten daher in einem solchen Konzept nicht berücksichtigt werden können. Hinzu kam, dass die für ein solches Modul notwendigen Vereinbarungen mit dem Kultusministerium in der Kürze der Projektlaufzeit nicht ausreichend detailliert hätten vorgenommen werden können. | ||
| Zeile 202: | Zeile 202: | ||
Die Handreichung kann im [https://www.ljrbw.de/publikationen/in-zukunft-mit-uns-die-drittelparitaet-in-der-schulkonferenz Onlineshop des Landesjugendrings] heruntergeladen werden. | Die Handreichung kann im [https://www.ljrbw.de/publikationen/in-zukunft-mit-uns-die-drittelparitaet-in-der-schulkonferenz Onlineshop des Landesjugendrings] heruntergeladen werden. | ||
==== Workshopmodul „Sich engagieren und demokratische Teilhabe befördern durch gute Kommunikation in der SMV-Arbeit“ ==== | |||
Auf Basis der im Abschlussbericht „Die Drittelparität in der Schulkonferenz“ formulierten Erkenntnisse konzipierte die in die Erstellung der Handreichung Nr. 4 eng eingebundene Multiplikatorin Vivianna Klarmann ein Sensibilisierungsmodul für Lehrer*innen (es wurden insbesondere die Vertrauenslehrer*innen angesprochen) sowie für Schüler*innen der SMV. Das Ziel des Moduls war es, die Beteiligungskultur zwischen Schüler*innen und Lehrer*innen zu fördern und aufzuzeigen, welche Möglichkeiten der Beteiligung und welche Wege der Umsetzung für die Beteiligung der Schüler*innen es im Schulalltag gibt. Ein besonderer Fokus lag auch auf der Frage der richtigen Kommunikation: Damit Schüler*innen etwas bewirken können, müssen sehr viele von ihnen am Meinungsbildungsprozess teilhaben. Die SMV muss durch einen Wahlprozess, der im Schulleben eine gewisse Bedeutung haben muss, ernannt werden. Nur so kann die SMV als legitime Vertreterin aller Schüler*innen mit weiteren Akteuren des Schullebens ins Gespräch treten und etwas bewirken. Zudem muss sich die SMV der Verantwortung eines solchen „Sprechens für alle“ bewusst sein. Es ist also wichtig, dass die SMV selbst zur breiten Beteiligung einlädt und diese vorlebt. Zugleich sollten Verbindungslehrerinnen und –lehrer darin sensibilisiert werden, welche Mittlerfunktion ihnen hierbei zukommen kann. | Auf Basis der im Abschlussbericht „Die Drittelparität in der Schulkonferenz“ formulierten Erkenntnisse konzipierte die in die Erstellung der Handreichung Nr. 4 eng eingebundene Multiplikatorin Vivianna Klarmann ein Sensibilisierungsmodul für Lehrer*innen (es wurden insbesondere die Vertrauenslehrer*innen angesprochen) sowie für Schüler*innen der SMV. Das Ziel des Moduls war es, die Beteiligungskultur zwischen Schüler*innen und Lehrer*innen zu fördern und aufzuzeigen, welche Möglichkeiten der Beteiligung und welche Wege der Umsetzung für die Beteiligung der Schüler*innen es im Schulalltag gibt. Ein besonderer Fokus lag auch auf der Frage der richtigen Kommunikation: Damit Schüler*innen etwas bewirken können, müssen sehr viele von ihnen am Meinungsbildungsprozess teilhaben. Die SMV muss durch einen Wahlprozess, der im Schulleben eine gewisse Bedeutung haben muss, ernannt werden. Nur so kann die SMV als legitime Vertreterin aller Schüler*innen mit weiteren Akteuren des Schullebens ins Gespräch treten und etwas bewirken. Zudem muss sich die SMV der Verantwortung eines solchen „Sprechens für alle“ bewusst sein. Es ist also wichtig, dass die SMV selbst zur breiten Beteiligung einlädt und diese vorlebt. Zugleich sollten Verbindungslehrerinnen und –lehrer darin sensibilisiert werden, welche Mittlerfunktion ihnen hierbei zukommen kann. | ||
| Zeile 231: | Zeile 231: | ||
Insgesamt waren 160 Teilnehmende vor Ort, wovon allerdings zwei Schulklassen aus St. Georgen nur bis zum von einer Schülerfirma bereiteten Mittagessen bleiben konnten. Am Nachmittag waren es knapp 90 Teilnehmende. Die Werbung zur Veranstaltung hatte sich somit gelohnt, war jedoch sehr ressourcenintensiv: Beteiligungsangebote von sämtlichen in der Nähe der Bahnstrecke liegenden Gemeinden sowie die Kontaktdaten zuständiger Personen wurden recherchiert, alle Personen wurden zunächst angeschrieben. Ein oder zwei weitere Anrufe waren in der Regel notwendig. Die Teilnehmenden kamen aus insgesamt 25 verschiedenen Gemeinden mit verschiedenen Jugendbeteiligungsmodellen. | Insgesamt waren 160 Teilnehmende vor Ort, wovon allerdings zwei Schulklassen aus St. Georgen nur bis zum von einer Schülerfirma bereiteten Mittagessen bleiben konnten. Am Nachmittag waren es knapp 90 Teilnehmende. Die Werbung zur Veranstaltung hatte sich somit gelohnt, war jedoch sehr ressourcenintensiv: Beteiligungsangebote von sämtlichen in der Nähe der Bahnstrecke liegenden Gemeinden sowie die Kontaktdaten zuständiger Personen wurden recherchiert, alle Personen wurden zunächst angeschrieben. Ein oder zwei weitere Anrufe waren in der Regel notwendig. Die Teilnehmenden kamen aus insgesamt 25 verschiedenen Gemeinden mit verschiedenen Jugendbeteiligungsmodellen. | ||
== Bilanzveranstaltung: Auch in Zukunft mit UNS! == | |||
Am 16.06.2016 fand im Stuttgarter Hospitalhof die Bilanzveranstaltung zum Projekt statt. Ziel der Veranstaltung war es, eine Bilanz zu ziehen und sich gegenseitig auszutauschen: Wer steht wo und wo steht das Land Baden-Württemberg insgesamt in Sachen Jugendbeteiligung. Zudem sollte ein Blick in die Zukunft gewagt werden: Was wünschen sich die Akteurinnen und Akteure und wer kann was dazu beitragen, diese Themen anzugehen? Eingeladen waren alle landesweit aktiven Akteur*innen der Jugendbeteiligung in Baden-Württemberg: Jugendliche, Vertretungen aus Politik und Verwaltung, Haupt- und Ehrenamtliche in Vereinen, Verbänden, Ringen, Kirchen und Bildungseinrichtungen. | Am 16.06.2016 fand im Stuttgarter Hospitalhof die Bilanzveranstaltung zum Projekt statt. Ziel der Veranstaltung war es, eine Bilanz zu ziehen und sich gegenseitig auszutauschen: Wer steht wo und wo steht das Land Baden-Württemberg insgesamt in Sachen Jugendbeteiligung. Zudem sollte ein Blick in die Zukunft gewagt werden: Was wünschen sich die Akteurinnen und Akteure und wer kann was dazu beitragen, diese Themen anzugehen? Eingeladen waren alle landesweit aktiven Akteur*innen der Jugendbeteiligung in Baden-Württemberg: Jugendliche, Vertretungen aus Politik und Verwaltung, Haupt- und Ehrenamtliche in Vereinen, Verbänden, Ringen, Kirchen und Bildungseinrichtungen. | ||
| Zeile 242: | Zeile 242: | ||
Insgesamt 65 Personen nahmen an der Veranstaltung teil. Die Teilnehmenden kamen überwiegend aus dem direkten Projektkontext, z. B. Mitglieder der Steuerungsgruppe oder mit dem Projekt in stetigem Austausch stehende Beteiligungsakteur*innen, wie z. B. LpB, Robert Bosch Stiftung etc. Teil des Veranstaltungskonzepts war es, den Tag so zu gestalten, dass auch möglichst viele weitere Akteur*innen der kommunalen Ebene sowie von Vereinen und Verbänden und insbesondere auch Jugendliche teilnehmen und die Projektbilanz sowie die sich ergebenden Forderungen mit dem „Blick von außen“ bereichern konnten. Solche projektexternen Akteurinnen und Akteure waren relativ wenige vor Ort. Für weitere Veranstaltungen dieser Art ist also noch erheblich mehr Zeit in die Werbung zu investieren. Sehr positiv hervorzuheben ist die Qualität der Ergebnisse der Bilanzveranstaltung: Alle Diskussionen in den Workshops erfolgten auf sehr hohem Niveau und waren getragen von einer konstruktiven Atmosphäre sowie einer fundierten Kenntnis der Situation in Baden-Württemberg und darüber hinaus. | Insgesamt 65 Personen nahmen an der Veranstaltung teil. Die Teilnehmenden kamen überwiegend aus dem direkten Projektkontext, z. B. Mitglieder der Steuerungsgruppe oder mit dem Projekt in stetigem Austausch stehende Beteiligungsakteur*innen, wie z. B. LpB, Robert Bosch Stiftung etc. Teil des Veranstaltungskonzepts war es, den Tag so zu gestalten, dass auch möglichst viele weitere Akteur*innen der kommunalen Ebene sowie von Vereinen und Verbänden und insbesondere auch Jugendliche teilnehmen und die Projektbilanz sowie die sich ergebenden Forderungen mit dem „Blick von außen“ bereichern konnten. Solche projektexternen Akteurinnen und Akteure waren relativ wenige vor Ort. Für weitere Veranstaltungen dieser Art ist also noch erheblich mehr Zeit in die Werbung zu investieren. Sehr positiv hervorzuheben ist die Qualität der Ergebnisse der Bilanzveranstaltung: Alle Diskussionen in den Workshops erfolgten auf sehr hohem Niveau und waren getragen von einer konstruktiven Atmosphäre sowie einer fundierten Kenntnis der Situation in Baden-Württemberg und darüber hinaus. | ||
=== Workshop „Wahl ab 16“ === | |||
Aus den vielen Argumenten, die die Arbeitsgruppe zur Absenkung des Wahlalters für Landtagswahlen sammelte, lassen sich zwei hervorheben: | Aus den vielen Argumenten, die die Arbeitsgruppe zur Absenkung des Wahlalters für Landtagswahlen sammelte, lassen sich zwei hervorheben: | ||
* Im Zuge des demographischen Wandels bekommen die Stimmen von Jugendlichen bei den meisten Themen ein immer geringeres Gewicht; die Wähler*innenschaft der über 60-jährigen nimmt zu, viele Parteien richten ihre Programme an den Älteren aus. | * Im Zuge des demographischen Wandels bekommen die Stimmen von Jugendlichen bei den meisten Themen ein immer geringeres Gewicht; die Wähler*innenschaft der über 60-jährigen nimmt zu, viele Parteien richten ihre Programme an den Älteren aus. | ||
| Zeile 249: | Zeile 249: | ||
„Vision: Alle sozialen Milieus sind motiviert, informiert und aktiv!“ | „Vision: Alle sozialen Milieus sind motiviert, informiert und aktiv!“ | ||
Oberste Priorität einer jeden Kampagne müsse sein, dass sie Jugendliche aller sozialen Milieus erreicht und darauf angelegt ist, diese mit dem Selbstbewusstsein und den Ressourcen auszustatten, ihre Anliegen neben dem Wahlakt auf vielfältige Weise in die Politik einzubringen. Milieus verstehen die Mitglieder der Arbeitsgruppe dabei im Sinne von „Lebenswirklichkeit“. So bilden Subkulturen oder unterschiedliche politische und lebensweltliche Einstellungen, z. B. durch die Prägung im Elternhaus, Milieus. Diese sind Teil einer vielfältigen Gesellschaft und müssen auf jeweils unterschiedlichem Wege erreicht werden, keinesfalls allein durch den Aufruf zur Teilnahme an der Wahl. Zur Unterstützung einer solchen milieusensiblen Jugendarbeit fordert die Arbeitsgruppe ausreichende und stabile finanzielle Mittel. Deren Vergabe soll berechenbar und rechtlich transparent erfolgen. | Oberste Priorität einer jeden Kampagne müsse sein, dass sie Jugendliche aller sozialen Milieus erreicht und darauf angelegt ist, diese mit dem Selbstbewusstsein und den Ressourcen auszustatten, ihre Anliegen neben dem Wahlakt auf vielfältige Weise in die Politik einzubringen. Milieus verstehen die Mitglieder der Arbeitsgruppe dabei im Sinne von „Lebenswirklichkeit“. So bilden Subkulturen oder unterschiedliche politische und lebensweltliche Einstellungen, z. B. durch die Prägung im Elternhaus, Milieus. Diese sind Teil einer vielfältigen Gesellschaft und müssen auf jeweils unterschiedlichem Wege erreicht werden, keinesfalls allein durch den Aufruf zur Teilnahme an der Wahl. Zur Unterstützung einer solchen milieusensiblen Jugendarbeit fordert die Arbeitsgruppe ausreichende und stabile finanzielle Mittel. Deren Vergabe soll berechenbar und rechtlich transparent erfolgen. | ||
„Demokratiebildung muss Hand in Hand mit Jugendbeteiligung und Selbstorganisation von Jugendlichen gehen!“ | „Demokratiebildung muss Hand in Hand mit Jugendbeteiligung und Selbstorganisation von Jugendlichen gehen!“ | ||
Ab 16 wählen zu können, dürfe, so der Fazit, keinesfalls das Ende der Fahnenstange in der Weiterentwicklung der Demokratie sein. Jugendliche engagieren sich zunehmend vielfältig und tendenziell projektorientiert – und somit fernab einer parteipolitischen Bindung. Dieses multiple Engagement gelte es zu befördern. Zentral sei aber auch, dass Jugendliche verstehen, wie aus der Zivilgesellschaft kommende politische Forderungen in die formalisierte Politik und später in die Gesetzgebung eingehen, wie politische Kompromissfindung funktioniert und wie man in diesem Prozess seine Ziele weiterverfolgen kann. Neben der Gewährung von Rechten sei daher auch eine Strategie für eine umfassende Demokratiebildung nötig. Diese müsse Hand in Hand gehen mit weiteren Formen der Beteiligung Jugendlicher und der Möglichkeit, Selbstorganisation Jugendlicher zu befördern. Hierzu brauche es eine finanziell gut ausgestattete Assistenzstruktur, die auch über den Tellerrand formaler Politik hinausschaut, ein Mentor*innenkonzept, sowie rechtliche Absicherung und höhere Verbindlichkeit von über das Wahlrecht hinausgehenden Beteiligungsformaten auf Landesebene. | Ab 16 wählen zu können, dürfe, so der Fazit, keinesfalls das Ende der Fahnenstange in der Weiterentwicklung der Demokratie sein. Jugendliche engagieren sich zunehmend vielfältig und tendenziell projektorientiert – und somit fernab einer parteipolitischen Bindung. Dieses multiple Engagement gelte es zu befördern. Zentral sei aber auch, dass Jugendliche verstehen, wie aus der Zivilgesellschaft kommende politische Forderungen in die formalisierte Politik und später in die Gesetzgebung eingehen, wie politische Kompromissfindung funktioniert und wie man in diesem Prozess seine Ziele weiterverfolgen kann. Neben der Gewährung von Rechten sei daher auch eine Strategie für eine umfassende Demokratiebildung nötig. Diese müsse Hand in Hand gehen mit weiteren Formen der Beteiligung Jugendlicher und der Möglichkeit, Selbstorganisation Jugendlicher zu befördern. Hierzu brauche es eine finanziell gut ausgestattete Assistenzstruktur, die auch über den Tellerrand formaler Politik hinausschaut, ein Mentor*innenkonzept, sowie rechtliche Absicherung und höhere Verbindlichkeit von über das Wahlrecht hinausgehenden Beteiligungsformaten auf Landesebene. | ||
=== Workshop Jugendbeteiligung in der Jugendgruppe === | |||
Es ging um die Frage, was es braucht, damit Vereine und Verbände auch künftig auf Know-How zum Thema zurückgreifen und ihre eigene Jugendarbeit stärken können. | Es ging um die Frage, was es braucht, damit Vereine und Verbände auch künftig auf Know-How zum Thema zurückgreifen und ihre eigene Jugendarbeit stärken können. | ||
„Gelebte Beteiligung braucht Ressourcen.“ | „Gelebte Beteiligung braucht Ressourcen.“ | ||
Für die Arbeitsgruppe „Beteiligung in der Jugendgruppe“ ist es wichtig, Jugendgruppen als Erfahrungsraum für Selbstbestimmung weiter zu stärken. Hierzu sei es notwendig, geeignete Methoden, positive Erfahrungen und Best Practice-Beispiele für die selbstorganisierte Jugendarbeit zu bündeln. Der Wissenstransfer unter den beteiligten Akteuren müsse sichergestellt werden. Hierbei könne eine landesweite Koordinierungsstelle mit geeigneten Schulungs- und Qualifizierungsangeboten unterstützend tätig werden. Zugleich können an einer solchen Stelle Erfahrungen darin gesammelt und weitergegeben werden, wie Verbände ihre eigene „Exklusivität“ aufbrechen und für Interessenten jenseits ihrer klassischen Zielgruppen interessant werden können. Thematisch wichtig sei es in der Qualifizierung insbesondere, die Selbstorganisation von Jugendvereinen und -verbänden in den Blick zu nehmen. Über Jahre gewachsene Hierarchien und Entscheidungsstrukturen sollten aktiv durch neue Mitglieder hinterfragt werden dürfen. | Für die Arbeitsgruppe „Beteiligung in der Jugendgruppe“ ist es wichtig, Jugendgruppen als Erfahrungsraum für Selbstbestimmung weiter zu stärken. Hierzu sei es notwendig, geeignete Methoden, positive Erfahrungen und Best Practice-Beispiele für die selbstorganisierte Jugendarbeit zu bündeln. Der Wissenstransfer unter den beteiligten Akteuren müsse sichergestellt werden. Hierbei könne eine landesweite Koordinierungsstelle mit geeigneten Schulungs- und Qualifizierungsangeboten unterstützend tätig werden. Zugleich können an einer solchen Stelle Erfahrungen darin gesammelt und weitergegeben werden, wie Verbände ihre eigene „Exklusivität“ aufbrechen und für Interessenten jenseits ihrer klassischen Zielgruppen interessant werden können. Thematisch wichtig sei es in der Qualifizierung insbesondere, die Selbstorganisation von Jugendvereinen und -verbänden in den Blick zu nehmen. Über Jahre gewachsene Hierarchien und Entscheidungsstrukturen sollten aktiv durch neue Mitglieder hinterfragt werden dürfen. | ||
Multiplikator*innenaus dem Projekt berichteten zudem, dass es kommunale Jugendringe es schwererer als Verbände hatten, Teilnehmende für die Angebote aus dem Projekt „In Zukunft mit UNS!“ zu begeistern. Verbände machten vom Angebot des Projekts direkt in ihren eigenen Strukturen Gebrauch und banden die Erkenntnisse in laufende Veränderungsprozesse oder in ihre Juleica-Schulung ein, diesen hands on-Vorteil haben Jugendringe weniger. Eine weitere Aufgabe einer Koordinierungsstelle könnte also darin liegen, die Ringe in der Öffentlichkeitsarbeit für solche Veranstaltungen zu unterstützen. | Multiplikator*innenaus dem Projekt berichteten zudem, dass es kommunale Jugendringe es schwererer als Verbände hatten, Teilnehmende für die Angebote aus dem Projekt „In Zukunft mit UNS!“ zu begeistern. Verbände machten vom Angebot des Projekts direkt in ihren eigenen Strukturen Gebrauch und banden die Erkenntnisse in laufende Veränderungsprozesse oder in ihre Juleica-Schulung ein, diesen hands on-Vorteil haben Jugendringe weniger. Eine weitere Aufgabe einer Koordinierungsstelle könnte also darin liegen, die Ringe in der Öffentlichkeitsarbeit für solche Veranstaltungen zu unterstützen. | ||
„Jugendbeteiligung braucht Jugendgruppen und -verbände als Beteiligungsexpertinnen!“ | „Jugendbeteiligung braucht Jugendgruppen und -verbände als Beteiligungsexpertinnen!“ | ||
Notwendigkeit sei aber auch, eine gelebte Beteiligungskultur sicherzustellen – das kann eine Koordinierungsstelle nach Ansicht der Arbeitsgruppe nicht leisten. Dazu brauche es insbesondere hauptamtliche Fachkräfte, die planungssicher in der selbstorganisierten Jugendarbeit angestellt sind und wertvolle Unterstützungsarbeit für die ehrenamtlich Engagierten leisten. Zudem falle echte Selbstorganisation zunehmend schwerer, da Vereine und Verbände oft durch Wünsche und Forderungen von außen vereinnahmt werden. Dies sei zum Beispiel im Hinblick auf Kooperation Jugendarbeit und Schule zu betrachten, wenn Vereine Teile des Nachmittagsangebots an Schulen stellen. Es brauche also, so der Fazit, auch den expliziten politischen Willen, die Eigenständigkeit der selbstorganisierten Kinder- und Jugendarbeit zu bewahren und ihre Erfahrungen als Beteiligungsexpertin zu schätzen. | Notwendigkeit sei aber auch, eine gelebte Beteiligungskultur sicherzustellen – das kann eine Koordinierungsstelle nach Ansicht der Arbeitsgruppe nicht leisten. Dazu brauche es insbesondere hauptamtliche Fachkräfte, die planungssicher in der selbstorganisierten Jugendarbeit angestellt sind und wertvolle Unterstützungsarbeit für die ehrenamtlich Engagierten leisten. Zudem falle echte Selbstorganisation zunehmend schwerer, da Vereine und Verbände oft durch Wünsche und Forderungen von außen vereinnahmt werden. Dies sei zum Beispiel im Hinblick auf Kooperation Jugendarbeit und Schule zu betrachten, wenn Vereine Teile des Nachmittagsangebots an Schulen stellen. Es brauche also, so der Fazit, auch den expliziten politischen Willen, die Eigenständigkeit der selbstorganisierten Kinder- und Jugendarbeit zu bewahren und ihre Erfahrungen als Beteiligungsexpertin zu schätzen. | ||
=== Jugendbeteiligung in der Kommune === | |||
„Damit kommunale Jugendbeteiligung selbstverständlich wird, braucht es Ressourcen, Strukturen, Haltungen und Inhalte!“ | „Damit kommunale Jugendbeteiligung selbstverständlich wird, braucht es Ressourcen, Strukturen, Haltungen und Inhalte!“ | ||
Die Teilnehmenden aus dem Workshop „Jugendbeteiligung in der Kommune“ wünschen sich noch mehr verbindliche Beteiligung sowie Strukturen, die zu einer Kultur der Beteiligung beitragen können. Hierzu fordern sie eine Koordinierungsstelle auf Landesebene. Diese soll: | Die Teilnehmenden aus dem Workshop „Jugendbeteiligung in der Kommune“ wünschen sich noch mehr verbindliche Beteiligung sowie Strukturen, die zu einer Kultur der Beteiligung beitragen können. Hierzu fordern sie eine Koordinierungsstelle auf Landesebene. Diese soll: | ||
| Zeile 276: | Zeile 280: | ||
Darüber hinaus fordert die Arbeitsgruppe, die Themen „Kommunalpolitik“ und „Beteiligung“ vermehrt in den Schulunterricht aufzunehmen, um Jugendliche fit für ihre Möglichkeiten zu machen. Die Förderung Jugendbeauftragter auf kommunaler Ebene ist eine weitere Forderung; hierfür müssen Jugendämter und Jugendpfleger*innen auch in kleinen Gemeinden über Ressourcen verfügen, damit sie Jugendbeteiligung als Querschnittsthema angehen können. Dies könne einerseits die Abstimmung mit den einzelnen Verwaltungsdezernaten der jeweiligen Kommune sicherstellen. Andererseits können damit Möglichkeiten eröffnet werden, weit über den häufig eng verstandenen Begriff der „Jugendhilfe“ hinaus Jugendliche in sie betreffende Themen und Anliegen einzubeziehen. | Darüber hinaus fordert die Arbeitsgruppe, die Themen „Kommunalpolitik“ und „Beteiligung“ vermehrt in den Schulunterricht aufzunehmen, um Jugendliche fit für ihre Möglichkeiten zu machen. Die Förderung Jugendbeauftragter auf kommunaler Ebene ist eine weitere Forderung; hierfür müssen Jugendämter und Jugendpfleger*innen auch in kleinen Gemeinden über Ressourcen verfügen, damit sie Jugendbeteiligung als Querschnittsthema angehen können. Dies könne einerseits die Abstimmung mit den einzelnen Verwaltungsdezernaten der jeweiligen Kommune sicherstellen. Andererseits können damit Möglichkeiten eröffnet werden, weit über den häufig eng verstandenen Begriff der „Jugendhilfe“ hinaus Jugendliche in sie betreffende Themen und Anliegen einzubeziehen. | ||
=== Jugendbeteiligung in der Schule === | |||
„Mehr Schülerinnen-Mitverwaltung wagen ‒ gelebte Beteiligung braucht mehr Raum im Schulalltag“ | „Mehr Schülerinnen-Mitverwaltung wagen ‒ gelebte Beteiligung braucht mehr Raum im Schulalltag“ | ||
Von allen „Orten der Beteiligung“, mit denen sich das Projekt beschäftigte, sehen die Teilnehmenden eine Demokratisierung der Schule als schwierigste Aufgabe an. Zu wenig sei die Institution Schule von ihrem Wesen her demokratisch. Zum Einstieg warf die Workshop-Gruppe daher den Blick auf eine Neuerung letzten Jahre, die eine Verbesserung der Beteiligungsmöglichkeiten von Schüler*innen vorsieht: Die Aufnahme der sogenannten „Drittelparität“ in das Schulgesetz von Baden-Württemberg. Mit ihr soll künftig ein Drittel der Stimmen in der Schulkonferenz Schüler*innen gehören. Dies sei in der Tat ein großer Schritt mit viel Potential. Doch komme nach Ansicht der Gruppe die Änderung bisher nicht in der Beteiligungskultur der Schulen an. Die neuen Möglichkeiten würden nicht von den Schulen im Sinne einer Ermutigung beworben, sich jetzt erst recht in der Schüler*innenmitverantwortung (SMV) zu engagieren. Auch würden Schüler*innen nicht sonderlich oft in einer Weise auf diese Beteiligungsmöglichkeit zurückgreifen, dass sie über die Erfüllung der Drittelparität in der Schulkonferenz hinaus auf eine demokratischere Schulkultur wirken könnte. Hier fehle die Vision und das Vertrauen, nachhaltige Antworten auf die Frage zu finden: „Was können wir Schülerinnnen und Schüler schon groß ändern?“ | Von allen „Orten der Beteiligung“, mit denen sich das Projekt beschäftigte, sehen die Teilnehmenden eine Demokratisierung der Schule als schwierigste Aufgabe an. Zu wenig sei die Institution Schule von ihrem Wesen her demokratisch. Zum Einstieg warf die Workshop-Gruppe daher den Blick auf eine Neuerung letzten Jahre, die eine Verbesserung der Beteiligungsmöglichkeiten von Schüler*innen vorsieht: Die Aufnahme der sogenannten „Drittelparität“ in das Schulgesetz von Baden-Württemberg. Mit ihr soll künftig ein Drittel der Stimmen in der Schulkonferenz Schüler*innen gehören. Dies sei in der Tat ein großer Schritt mit viel Potential. Doch komme nach Ansicht der Gruppe die Änderung bisher nicht in der Beteiligungskultur der Schulen an. Die neuen Möglichkeiten würden nicht von den Schulen im Sinne einer Ermutigung beworben, sich jetzt erst recht in der Schüler*innenmitverantwortung (SMV) zu engagieren. Auch würden Schüler*innen nicht sonderlich oft in einer Weise auf diese Beteiligungsmöglichkeit zurückgreifen, dass sie über die Erfüllung der Drittelparität in der Schulkonferenz hinaus auf eine demokratischere Schulkultur wirken könnte. Hier fehle die Vision und das Vertrauen, nachhaltige Antworten auf die Frage zu finden: „Was können wir Schülerinnnen und Schüler schon groß ändern?“ | ||
| Zeile 284: | Zeile 289: | ||
Weiter empfiehlt die Arbeitsgruppe, dass entweder die Vertrauenslehrer*innenfür Beteiligungsfragen fortgebildet werden sollen oder dass eigene Ansprechpartner*innen für Beteiligungsfragen benannt und entsprechend auf ihre Aufgabe vorbereitet werden sollen. | Weiter empfiehlt die Arbeitsgruppe, dass entweder die Vertrauenslehrer*innenfür Beteiligungsfragen fortgebildet werden sollen oder dass eigene Ansprechpartner*innen für Beteiligungsfragen benannt und entsprechend auf ihre Aufgabe vorbereitet werden sollen. | ||
=== Vernetzung von Aktiven der Jugendbeteiligung === | |||
Wie kann eine Vernetzung aller relevanten Akteure auch unabhängig von einem einzelnen Projekt dauerhaft gestärkt werden? In allen Phasen des Projekts hat die Projektstelle „In Zukunft mit UNS!“ die Erfahrung gemacht, dass es ein Team von fest eingebundenen Multiplikator*innen braucht, um möglichst viele Jugendliche aus verschiedenen Jugendkulturen zu erreichen. Zudem müssen Plattformen geschaffen werden, um den Austausch zwischen Jugendvertretungen und den Verantwortungsträger*innn aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft anzuregen und stabile Netzwerke zu etablieren. Deshalb war es der Projektstelle ein zentrales Anliegen, Jugendliche und junge Erwachsene als Multiplikator*innen zu qualifizieren und einzubinden und im Rahmen von dialogorientierten Veranstaltungen Gelegenheit zur Vernetzung auf allen Ebenen zu geben. | Wie kann eine Vernetzung aller relevanten Akteure auch unabhängig von einem einzelnen Projekt dauerhaft gestärkt werden? In allen Phasen des Projekts hat die Projektstelle „In Zukunft mit UNS!“ die Erfahrung gemacht, dass es ein Team von fest eingebundenen Multiplikator*innen braucht, um möglichst viele Jugendliche aus verschiedenen Jugendkulturen zu erreichen. Zudem müssen Plattformen geschaffen werden, um den Austausch zwischen Jugendvertretungen und den Verantwortungsträger*innn aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft anzuregen und stabile Netzwerke zu etablieren. Deshalb war es der Projektstelle ein zentrales Anliegen, Jugendliche und junge Erwachsene als Multiplikator*innen zu qualifizieren und einzubinden und im Rahmen von dialogorientierten Veranstaltungen Gelegenheit zur Vernetzung auf allen Ebenen zu geben. | ||
„Es braucht Ansprechpersonen zum Thema Jugendbeteiligung auf kommunaler Ebene in Verwaltung und Schule.“ | „Es braucht Ansprechpersonen zum Thema Jugendbeteiligung auf kommunaler Ebene in Verwaltung und Schule.“ | ||
Ziel jeglicher Vernetzungsaktivitäten ist es nach Ansicht der Gruppe, einen umfassenden Wissenstransfer zu ermöglichen und stabil im Fluss zu halten. Gute Ideen und Umsetzungsbeispiele zum Thema „Beteiligung“ mit unterschiedlichen Zielgruppen gebe es an vielen Stellen im Land. Oft seien diese beispielhaften Beteiligungsstrukturen jedoch vom Engagement einzelner Personen abhängig. Die Gruppe bekräftigte deshalb die Forderung, eine landesweite Koordinierungsstelle einzurichten. Diese solle umfangreiche Funktionen erfüllen: | Ziel jeglicher Vernetzungsaktivitäten ist es nach Ansicht der Gruppe, einen umfassenden Wissenstransfer zu ermöglichen und stabil im Fluss zu halten. Gute Ideen und Umsetzungsbeispiele zum Thema „Beteiligung“ mit unterschiedlichen Zielgruppen gebe es an vielen Stellen im Land. Oft seien diese beispielhaften Beteiligungsstrukturen jedoch vom Engagement einzelner Personen abhängig. Die Gruppe bekräftigte deshalb die Forderung, eine landesweite Koordinierungsstelle einzurichten. Diese solle umfangreiche Funktionen erfüllen: | ||
* Aufbau und Unterhalt einer „Multiplikator*innen-Akademie“ und Vermittlung von Multiplikator*innen, | * Aufbau und Unterhalt einer „Multiplikator*innen-Akademie“ und Vermittlung von Multiplikator*innen, | ||
| Zeile 297: | Zeile 303: | ||
Neben der landesweiten Koordination fordert die Arbeitsgruppe zudem Koordinierungsstellen oder zumindest feste Ansprechpersonen in den kommunalen Ringen oder den Jugendreferaten in den Kreisen, Städten und Gemeinden Baden-Württemberg: Diese sollen mit den Kenntnissen der Angebote und Akteure vor Ort in der Lage sein, die unterschiedlichen Beteiligungsorte und -Zielgruppen zusammen zu bringen und mit der landesweiten Koordination Hand in Hand arbeiten. | Neben der landesweiten Koordination fordert die Arbeitsgruppe zudem Koordinierungsstellen oder zumindest feste Ansprechpersonen in den kommunalen Ringen oder den Jugendreferaten in den Kreisen, Städten und Gemeinden Baden-Württemberg: Diese sollen mit den Kenntnissen der Angebote und Akteure vor Ort in der Lage sein, die unterschiedlichen Beteiligungsorte und -Zielgruppen zusammen zu bringen und mit der landesweiten Koordination Hand in Hand arbeiten. | ||
==== Abschlussdiskussion ==== | |||
Die Diskussionsergebnisse und Projekterfahrungen können auf | Die Diskussionsergebnisse und Projekterfahrungen können auf fünf Empfehlungen für eine gelingende Jugendbeteiligung in Schulen, Verbänden und Kommunen zugespitzt werden: | ||
# Jugendbeteiligung ist mehr als Wählen. Jugendliche können an vielen Orten ihres Lebensumfeldes (Schule, Kommune, persönliches Umfeld) positive Beteiligungserfahrungen machen. Deshalb ist Jugendbeteiligung eine gesellschaftliche Zukunftsaufgabe, die über Institutionen hinweg gedacht und im Alltag verankert werden muss. | # Jugendbeteiligung ist mehr als Wählen. Jugendliche können an vielen Orten ihres Lebensumfeldes (Schule, Kommune, persönliches Umfeld) positive Beteiligungserfahrungen machen. Deshalb ist Jugendbeteiligung eine gesellschaftliche Zukunftsaufgabe, die über Institutionen hinweg gedacht und im Alltag verankert werden muss. | ||
# Jugendliche sollten schon früh in ihrem persönlichen Lebensumfeld positive Partizipationserfahrungen machen und mit der Übernahme von Verantwortung experimentieren können. Der nicht-schulische und nicht-formalpolitische Rahmen von Vereinen und Verbänden ist hierfür bestens geeignet. | # Jugendliche sollten schon früh in ihrem persönlichen Lebensumfeld positive Partizipationserfahrungen machen und mit der Übernahme von Verantwortung experimentieren können. Der nicht-schulische und nicht-formalpolitische Rahmen von Vereinen und Verbänden ist hierfür bestens geeignet. | ||
| Zeile 313: | Zeile 319: | ||
# Um Jugendbeteiligung zu stärken ist es notwendig, dass Schulen, Jugendverbände, Jugendringe, Kommunen, zivilgesellschaftliche Organisationen und die Jugendsozialarbeit eng zusammenarbeiten und Kräfte bündeln. Ein stabiles Netzwerke, gut qualifizierte und engagierte Multiplikator*innen sowie eine Kultur des Gehörtwerdens sind zentrale Voraussetzungen für das Gelingen von Beteiligungsverfahren. | # Um Jugendbeteiligung zu stärken ist es notwendig, dass Schulen, Jugendverbände, Jugendringe, Kommunen, zivilgesellschaftliche Organisationen und die Jugendsozialarbeit eng zusammenarbeiten und Kräfte bündeln. Ein stabiles Netzwerke, gut qualifizierte und engagierte Multiplikator*innen sowie eine Kultur des Gehörtwerdens sind zentrale Voraussetzungen für das Gelingen von Beteiligungsverfahren. | ||
# Zukünftige Initiativen zur Jugendbeteiligung müssen sowohl bereits motivierte Jugendliche erreichen, als auch „stille Gruppen“ berücksichtigen. Hierzu ist es notwendig, die Akteurinnen und Akteure der Jugendsozialarbeit und der mobilen Jugendarbeit (z. B. Streetworker*innen) und deren Erfahrungen verstärkt einzubeziehen. | # Zukünftige Initiativen zur Jugendbeteiligung müssen sowohl bereits motivierte Jugendliche erreichen, als auch „stille Gruppen“ berücksichtigen. Hierzu ist es notwendig, die Akteurinnen und Akteure der Jugendsozialarbeit und der mobilen Jugendarbeit (z. B. Streetworker*innen) und deren Erfahrungen verstärkt einzubeziehen. | ||
== Alle Downloads (zip-Dateien) == | |||
* [[Medium:IZmU Methodensammlung komplett.zip|Methodensammlung komplett]] | |||
* [[Medium:Zusatzmaterial zu Jugendbeteiligung in Jugendgruppen.zip|Zusatzmaterial zu Jugendbeteiligung in Jugendgruppen]] | |||
* [[Medium:Planspiel Neuland Nord Version-mit-Jugendgemeinderat.zip|Planspiel Neuland Nord (Version mit Jugendgemeinderat)]] | |||
* [[Medium:Mat01 Stationenlernen.zip|Stationenlernen]] | |||
* [[Medium:Mat02_Planspiel_Wahlingen.zip|Planspiel Wahlingen]] | |||
* [[Medium:Mat03 Planspiel Wahlsberg 1.zip|Planspiel Wahlsberg]] | |||
* [[Medium:Mat3e Wahlsberg Erweiterung-Kommunalwahl.zip|Erweiterung Kommunalwahl zum Planspiel Wahlsberg]] | |||
* [[Medium:Mat04 Planspiel Neckardorf.zip|Planspiel Neckardorf]] | |||
[[Kategorie:LJR-Projekte]] | [[Kategorie:LJR-Projekte]] | ||
[[Kategorie:Jugendbeteilung]] | [[Kategorie:Jugendbeteilung]] | ||
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2025, 09:28 Uhr
| In Zukunft mit UNS! | |
|---|---|
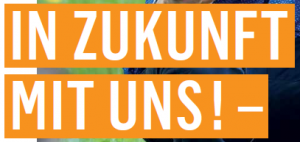 | |
| Projektbeginn: | 2013 |
| Projektende: | 2016 |
| Projektträger: | Landesjugendring BW |
| Finanzierung: | Baden-Württemberg Stiftung |
Hintergrund und Zielsetzung des Projekts
„In Zukunft mit UNS!“ war ein Projekt der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH und wurde vom Landesjugendring Baden-Württemberg in Abstimmung mit der Landeszentrale für politische Bildung durchgeführt. Ziel war es, Jugendliche zu befähigen, sich aktiv für eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen und für mehr Demokratie in ihrem Lebensumfeld einzusetzen. Zusätzlich wurden im Laufe des Projekts auch erwachsene Mitarbeitende der Verwaltung als Zielgruppe einbezogen: Jugendbeteiligung ist eine Querschnittsaufgabe in der Verwaltung. Auch fähige Jugendliche können im kommunalen Umfeld nicht viel erreichen, wenn die Gemeinde nicht ebenfalls von der Wichtigkeit der Jugendbeteiligung überzeugt ist, nicht wesentliche Methoden und Verfahren kennt und sich nicht über grundsätzliche rechtliche Rahmenbedingungen bewusst ist. Aus diesem Gedanken ist weiterhin das Qualifizierungsangebot „Aktivierende Jugendbeteiligung“ entstanden.
Formal gliederte sich das Projekt in zwei Phasen:
- Phase I: In Zukunft mit UNS! ‒ Wahl ab 16 (bei den Kommunalwahlen 2014)
- Phase II: In Zukunft mit UNS! ‒ Qualifizierung Jugendlicher in Beteiligungsprozessen
Projektphase 1: Wahl ab 16
Bündnis „Wählen ab 16“
Die erste Projektphase bildete den Beitrag der Baden-Württemberg Stiftung zum Bündnis „Wählen ab 16“ anlässlich der Kommunalwahlen 2014. Die Bündnispartner waren: Landesjugendring BW e.V., Landeszentrale für politische Bildung BW, Baden-Württemberg Stiftung gGmbH, Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten BW e.V., Baden-Württembergische SportJugend im Landessportverband BW e.V., Dachverband der Jugendgemeinderäte BW e.V., Evangelische Akademie Bad Boll, Fraktionen im Landtag (CDU, Bündnis 90/Die Grünen, SPD, FDP/DVP), Friedrich-Naumann Stiftung für die Freiheit, Fritz-Erler-Forum BW (Landesbüro der Friedrich-Ebert Stiftung), Gemeindenetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, Heinrich Böll Stiftung, Innenministerium BW, Internationales Forum Burg Liebenzell e.V., Jugendpresse BW e.V., Jugendstiftung BW, Katholische Akademie Hohenheim, Kreisjugendring Esslingen e.V., Kommunale Spitzenverbände (Städtetag, Gemeindetag, Landkreistag), Konrad-Adenauer-Stiftung, Landesanstalt für Kommunikation BW, Landesarbeitsgemeinschaft Offene Jugendbildung BW, Landesfrauenrat BW, Landesschülerbeirat BW, Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren BW, Ministerium für Integration BW, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport BW, Mehr Demokratie e.V., Ring politischer Jugend BW (Grüne Jugend, Junge Liberale, Junge Union, Jusos), Stadt Filderstadt, Referat für Bürgerbeteiligung und Stadtentwicklung, Stadtjugendring Stuttgart e.V., Stuttgarter Jugendhaus gGmbH, Verband Region Stuttgart, VHS-Landesverband BW e.V., Radio Energy, Stuggi.tv, yaez Verlag. Federführend im Bündnis waren der Landesjugendring BW (LJR) und die Landeszentrale für politische Bildung BW (LpB).
Landespressekonferenz
Am 20.02.2014 ging das Bündnis „Wählen ab 16“ mit einer Landespressekonferenz (LPK) an die Öffentlichkeit. Verbunden hiermit waren die gleichzeitige Freischaltung der Bündniswebsite, die Veröffentlichung des Angebotskatalogs des Bündnisses (online und als gedruckte Broschüre) sowie die Möglichkeit, online Aktionstage des Projekts „In Zukunft mit UNS!“ zu buchen.
Angebotskatalog und Homepage
Der Angebotskatalog des Bündnisses erschien als DIN lang-Broschüre. In dieser wurden die Initiatoren des Bündnisses – die LpB und der LJR – sowie die Baden-Württemberg Stiftung als Trägerin des größten Einzelbeitrags vorgestellt. Alle weiteren Bündnispartner wurden aufgelistet. Die auf Aktionstage bezogenen Angebote aus dem Projekt „In Zukunft mit UNS!“ wurden auf drei Seiten ausführlich vorgestellt (Angebotsnummern 101–106). Auf der Bündnishomepage http://waehlenab16-bw.de wurden analog zum Angebotskatalog die Angebote aller Bündnispartner vorgestellt – diese konnten direkt online angefragt oder gebucht werden. Die Anmeldungen zu Aktionstagen des Projekts „In Zukunft mit UNS!“ wurden per E-Mail an die Projektfachstelle weitergeleitet. Materialien der Bündnispartner konnten als PDF-Dateien heruntergeladen werden, so auch die Handreichung 1 und die Arbeitsmaterialien aus dem Projekt „In Zukunft mit UNS! . Darüber hinaus gab es textlich und audiovisuell aufbereitete Hilfen zum Thema „Wählen ab 16“, Testimonials, ein Erklärvideo und Social Media-Verknüpfungen. Auch die Online-Wahlsimulation des Projekts „In Zukunft mit UNS!“ wurde auf dem Server des Bündnisangebots „gehostet“ und auf der Startseite der Bündnishomepage verlinkt.
Werbung für Aktionstage im Rahmen kommunaler Bündnisse
Ein wichtiger Tätigkeitsbereich insbesondere von Oktober 2013 bis Februar 2014 war die Werbung zur Gründung kommunaler Bündnisse.
Gewinnung und Qualifizierung von Multiplikator*innen
Die Schulungen
Insgesamt wurden fünf Multiplikator*innen-Schulungen durchgeführt:
- 20./21.12.2013 in Bad Liebenzell: 45 Teilnehmende mit Vorerfahrung aus allen Regierungsbezirken. Konzentration auf Großgruppenmoderationsmethoden.
- 10./11.1.2014 in Freiburg: 25 Teilnehmende aus dem Regierungsbezirk Freiburg
- 18./19.1.2014 in Heidelberg: 25 Teilnehmende aus dem Regierungsbezirk Karlsruhe
- 25./26.1.2014 in Stuttgart: 21 Teilnehmende aus dem Regierungsbezirk Stuttgart
- 31.1.–2.2.2014 in Weingarten bei Ravensburg: 24 Teilnehmende aus dem Regierungsbezirk Tübingen.
Die folgenden Bausteine standen im Zentrum der Schulungen:
- Einführung in die Struktur des Projekts und des Bündnisses „Wählen ab 16“
- Vorbereitung auf die späteren Aufgaben
- Einführung in Kommunalpolitik, Erfahrungsaustausch zum Thema
- Einführung in das Thema „Beteiligung und Demokratie“
- Durchspielen jeweils exemplarischer Methoden aus den Modulen:
- Aktivierung und Kennenlernen
- Hinführung zum Thema
- Inhaltliche Grundmodule
- Plan- und Rollenspiele
- Stationenlernen
- Moderationsmethoden
- Ergebnissicherung
- Reflexion und Evaluation
- Rollenwechsel: Reflexion der jeweiligen Methode aus der Perspektive von Teilnehmenden: Worauf ist zu achten, welche Methode eignet sich besonders für welche Zielgruppe?
- Organisatorisches und Beantwortung offen gebliebener Fragen
Grundsätzlich waren die Teilnehmenden sehr zufrieden mit den Schulungen. Mehrfach kritisch angemerkt wurde der lange Leerlauf zwischen den Schulungen (insbesondere derjenigen in Bad Liebenzell im Dezember 2013) und der heißen Phase der Aktionstage.
Handreichung Nr. 1: Methodenhandbuch und Arbeitsmaterialien für Multiplikatorinnen und Interessierte
Das Methodenhandbuch folgt im Wesentlichen dem Aufbau der Schulungen und damit auch dem der Aktionstage. Den Schwerpunkt bilden Kurzbeschreibungen aller vorgestellten Methoden. Vorangestellt sind jeweils Angaben zur Zielgruppe, zur idealen Teilnehmendenzahl, zu benötigtem Material, zu Bedingungen an die Räumlichkeiten, zum Schwierigkeitsgrad der Methode und zu deren didaktischem Hauptziel. Zu den meisten Methoden gehören umfangreiche Arbeitsmaterialien (insgesamt ca. 270 Seiten), die noch beim Landesjugendring abgerufen werden können. Das Methodenhandbuch „In Zukunft mit UNS! Wahl ab 16“ kann beim Landesjugendring heruntergeladen werden: https://www.ljrbw.de/publikationen/in-zukunft-mit-uns-wahl-ab-16
Organisation und Durchführung von Aktionstagen
Insgesamt wurden 72 Aktionstage in verschiedenen Modellvarianten durchgeführt. Die Varianten waren:
- Moderierte Veranstaltungen
- Kommunalpolitische Planspiele
- Stationenlernen: Unterwegs in der Gemeinde
- Das Wahl-ABC
- Speed-Dating
- eigene Formate
Am gefragtesten waren die Varianten Speed-Dating, Stationenlernen und Wahl-ABC – die meisten Veranstalter*innen entschieden sich aber für eigene Formate.
Online-Wahlsimulation
Es wurde begleitend eine „internetbasierte Wahlsimulation“ entwickelt, welche am 08.05.2014 über den Server des Bündnisses „Wählen ab 16“ online ging. Ziel der Simulation war es, Jugendlichen und älteren Interessierten die Besonderheiten des Kommunalwahlrechts in Baden-Württemberg aufzuzeigen und verständlich zu machen. Gemeinde, Kreise und der Verband Region Stuttgart konnten über eine Excel-Schnittstelle die Kandidierenden der vor Ort antretenden Listen in die Simulation eintragen. Die Nutzer*innen konnten dann anhand dieser realen Listen ‒ bzw. in Gebietskörperschaften, welche sich nicht beteiligt hatten, anhand von fiktiven Listen ‒ ihre Stimmzettel ausfüllen und dabei von allen Regeln des baden-württembergischen Kommunalwahlrechts Gebrauch machen. Nach dem fiktiven Abgeben des Stimmzettels erhielten die Nutzer*innen und Nutzer eine Rückmeldung dazu, ob ihre Stimmen gültig sind und wenn nein, warum nicht. Auch gab es eine Rückmeldung in Fällen, in denen zwar Stimmen verschenkt worden, der Stimmzettel jedoch gültig gewesen wäre.
Projektphase 2 und 3: Qualifizierung Jugendlicher in Beteiligungsprozessen
Drei Orte der Jugendbeteiligung
Im Land Baden-Württemberg war im Themenkomplex „Bürger- und Jugendbeteiligung“ vieles in Bewegung. Als drei Orte, an denen dies besonders spürbar ist – sei es durch vollzogene oder geplante gesetzliche Änderungen der Rahmenbedingungen oder durch einen Eingang des Beteiligungsdiskurses in die Beteiligungspraxis – wurden insbesondere Kommunen, Schulen sowie Zivilgesellschaft, vor allem die Vereine und Verbände im Land, identifiziert. Zudem wurde die Notwendigkeit gesehen, auch Mitarbeitende der Verwaltung sowie Pädagog*innen an Schulen für die Maßnahmen des Projekts und das Thema „Jugendbeteiligung“ im Allgemeinen zu sensibilisieren. Hieraus ergeben sich die drei Säulen der zweiten und dritten Projektphase: Azubis in Verwaltungen, Jugendgruppenleitungen und Schüler*innen. Sie sollten dabei unterstützen, Jugendbeteiligung in Baden-Württemberg hin zu einer Beteiligungskultur zu entwickeln: etablierte Strukturen der kommunalen Jugendbeteiligung, Vereine und Verbände als Lernorte von Demokratie und Verantwortung und junge Menschen, die sich selbstbewusst für ihre Belange einsetzen.
Neben der Durchführung von Schulungen traten die Erstellung von geeigneten Sensibilisierungsmodulen für die drei Orte der Jugendbeteiligung, die dafür notwendige Recherchearbeit, die Aufbereitung der Ergebnisse in drei weiteren Arbeitshilfen sowie in einem letzten Schritt die Pilotierung und weitere Durchführung der Angebote zum Gewinn von Erfahrungen in den Vordergrund der Projektmaßnahmen.
erfahrene Multiplikator*innen erarbeiten drei Handreichungen und Schulungsmodule
Für die Recherche sowie für die Ausarbeitung der Module und deren Verschriftlichung in den Arbeitshilfen hat die Projektfachstelle im August und September 2014 ein Team von 11 Multiplikator*innen („Multis“) zusammengestellt. Als Auswahlkriterium diente eine Kurzbewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und verbindlichen Aussagen zum bis März 2015 für das Projekt zur Verfügung stehenden Zeitbudget. Alle 11 Multis waren bereits in der ersten Projektphase im Einsatz. Sie wurden per Werkvertrag in das Projekt eingebunden und teilten sich entsprechend der Zielgruppen „Schule“, „Kommunen“ und „Vereine & Verbände“ in drei Arbeitsgruppen auf.
Die Arbeitsgruppen „Jugendgruppe“ und „Kommune“ planten jeweils eine Handreichung sowie ein dazugehörendes Workshop-Angebot. Die Arbeitsgruppe „Schule“ blieb zunächst bei einer Handreichung, da für diese erheblich mehr Vorabrecherche zu leisten war. Die Weiterbearbeitung der Ergebnisse zu einem Workshop-Modul erfolgte im Herbst 2015. Hier blieb es bei einer Pilotdurchführung. Die Arbeit der Multis erfolgte in allen drei Gruppen innerhalb eines durch die Projektfachstelle vorgegebenen Rahmens so frei wie möglich. Ein Abgleich zwischen den Ideen der Multis und den für die Projektfachstelle verbindlichen Projektzielen erfolgte durch wöchentliche Telefonkonferenzen der drei Gruppen sowie durch drei gemeinsame Wochenend-Workshops.
Workshops zur Konzepterstellung
Das konkrete Vorgehen wurde in drei Workshops vom 16.‒17.10.2014 in Rottenburg, vom 31.10.‒02.11.2014 in Rastatt sowie vom 16.‒18.01.2015 in Bad Herrenalb detailliert geplant. In Rottenburg wurde gemeinsam mit Vertreter*innen das Grobkonzept erarbeitet. In Rastatt wurde bis zur Zuweisung von Detailaufgaben auf die beteiligten Multis und der Aufstellung eines genauen Zeitplans das gemeinsame Projektmanagement besprochen. In Bad Herrenalb wurden die Zwischenergebnisse zusammengetragen, in der gemeinsamen Diskussion auf Durchführbarkeit und Konsistenz geprüft und die Broschüren bis auf Absatzebene feingegliedert.
Jugendbeteiligung in der Kommune
Das Ziel der vierköpfigen Arbeitsgruppe „Jugendbeteiligung in der Kommune“ und der Projektfachstelle war die Aufbereitung von praxisrelevanten Informationen in einer Handreichung sowie die parallele Erarbeitung eines Sensibilisierungsmoduls für am Thema interessierte Jugendliche in der Kommune.
Handreichung Nr. 2: „Jugendbeteiligung in der Kommunen
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe wurden im April 2015 als Handreichung Nr. 2 „Jugendbeteiligung in der Kommune“ veröffentlicht. Die Broschüre richtet sich an Mitarbeitende der Verwaltung sowie an Auszubildende, die in einer Art Brückenfunktion bestimmte Aufgaben im Themenfeld „Jugendbeteiligung“ in der Kommune wahrnehmen können. Die Handreichung gliedert sich in drei Hauptkapitel:
- Zunächst werden den Aktiven vor Ort in einem Kapitel „Wozu Jugendbeteiligung?“ Argumente an die Hand gegeben, die dafür sprechen, sich vor Ort für eine lebendige Jugendbeteiligungskultur einzusetzen. Diese sollten insbesondere als Hilfestellung dienen, um das Thema gegenüber der Politik vor Ort stark zu machen.
- Im Hauptteil werden mehrere denkbare Formen der Jugendbeteiligung, vom klassischen Jugendgemeinderat über Schülerräte und sog. 8er-Räte bis hin zu Jugendkonferenzen, Jugendforen und Jugendhearings ausführlicher vorgestellt, wobei auch auf verschiedene Varianten ein- und derselben Methode eingegangen wird und Stärken und Schwächen sowie Bedingungen für ihr Funktionieren aufgeführt werden. Die verschiedenen Formen werden zueinander in Beziehung gebracht und in ein Analyseraster nach dem Grad ihrer Offenheit für verschiedene Zielgruppen und dem Grad ihrer institutionellen Festlegung einsortiert.
- Abschließend wird auf die Frage eingegangen, wie Jugendbeteiligung vor Ort gelingen kann. Dieses Kapitel wird durch eine Checkliste abgerundet.
Die Handreichung kann im Onlineshop des Landesjugendrings heruntergeladen werden.
Workshopmodul und Arbeitsmaterialien „Das Heft in der Hand“
Parallel zur Handreichung Nr. 2 entstand das Workshopmodul. Zielgruppe waren Auszubildende in den Verwaltungen und weitere in der Kommune aktive Jugendliche. Ziel war es, diese für das Thema Jugendbeteiligung zu sensibilisieren und dafür zu qualifizieren, sich selbst vor Ort in einer Weise einzubringen, die es wiederum anderen Jugendlichen leichter macht, sich vor Ort für ihre eigenen Belange einzusetzen. Der Aufbau ähnelte dem der Handreichung Nr. 2. Argumente für Jugendbeteiligung sollten gemeinsam mit den Jugendlichen erarbeitet werden. Eine Beschäftigung mit verschiedenen Modellen der Jugendbeteiligung erfolgte zunächst in Gruppenarbeit, vertiefend dann in Rollenspielen, in denen einzelne Methoden in Kurzform simuliert wurden. Die Systematisierung erfolgte im Plenum, ebenso wie die Erarbeitung von Gelingensfaktoren und Umsetzungsideen. Der Workshop wurde nur dreimal nachgefragt, da insbesondere die Vorleistung der Kommunen sehr hoch war: eine solche Veranstaltung vor Ort zu organisieren, die Auszubildenden einen Tag hierfür freizustellen bzw. weitere vor Ort aktive Jugendliche zu motivieren und eine Schulfreistellung zu erwirken. Als Reaktion entschloss sich die Projektfachstelle, das Modul im Januar 2016 neu zu bewerben und den Fokus auf die Auszubildenden in den Kommunen etwas zurückzustellen. Nun lag der Fokus darauf, Jugendliche und Angestellte der Verwaltungen an einen Tisch zu bringen. Dies wurde gerade mit Blick darauf, auch die Angestellten in den Kommunen zu adressieren, als sinnvoll erachtet. Im Vergleich zur ursprünglichen Konzeption wurde das Konzept dem des Moduls „Beteiligung in der Jugendgruppe“ angeglichen und der Tagesablauf und die Lernziele erfolgten in enger vorheriger Abstimmung mit der Projektfachstelle und nach den Bedürfnissen der nachfragenden Kommune.
Die Workshops im Einzelnen:
- 12.01.2015 in Schwäbisch Gmünd: Workshop mit 15 Auszubildenden der Stadt jeglicher Fachrichtung. Der Aufbau folgte noch dem ursprünglichen Konzept. Die Teilnehmenden beschrieben den Workshop als interessante Anregung. Da sie allerdings aus den unterschiedlichsten Ausbildungszweigen innerhalb der Stadt kamen ‒ dabei waren etwa Auszubildende in Gartenbau, technischen Berufen und Sozialberufen ‒ gaben einige Teilnehmende in der Feedbackrunde an, dass es ihnen schwer gefallen sei, den Bezug des eigenen Ausbildungszweigs zum Thema Jugendbeteiligung zu finden. Hier hätte flexibler auf die Heterogenität der Gruppe, die allerdings erst wenige Tage vor der Veranstaltung absehbar war, reagiert werden können. Denn wichtig war es aus Sicht des Projekts, gerade auch denjenigen späteren Mitarbeitenden von Stadtverwaltungen, die nicht an den klassischen „Jugendbeteiligungshebeln“ sitzen (Bürgermeister, Jugendreferent*innen, Baudezernat,…) im Kleinen aufzuzeigen, dass Jugendbeteiligung eine Grundhaltung ist, die überall mitgedacht werden muss und die im Alltag erheblich präsenter ist, als in formalisierten und großangelegten Beteiligungsprozessen, welche dann tatsächlich von anderen Bereichen der Verwaltung organisiert und in der Regel extern moderiert werden.
- 07.03.2016 in Emmendingen: Dieser Workshop mit neun Jugendlichen und angestellten Aktiven im Themenfeld „Jugendbeteiligung“ knüpfte direkt an die Gemeindeordnungsnovelle im Dezember 2015 an: In Vorgesprächen wurde schnell klar, dass die Teilnehmenden die neue Regelung gerne näher erläutert hätten und darauf aufbauend erfahren möchten, was sie vor Ort machen können. Hier wurden, anknüpfend an das bestehende Konzept, allerdings mit veränderten Methoden, Gemeinsamkeiten, Unterschiede und vor allem Kombinationsmöglichkeiten von Klassikern der Jugendbeteiligung diskutiert, wobei im Unterschied zum Workshop in Schwäbisch-Gmünd auf Vorkenntnissen der Teilnehmenden aufgebaut werden konnte.
- 02.04.2016 in Ulm: Die Teilnehmenden waren Jugendliche des Jugendparlaments (JuPa) Ulm. Ziel war es, mit den Jugendlichen zusammen zu erarbeiten, was diese mit dem JuPa in der nahen und ferneren Zukunft erreichen wollen bzw. wie sie sich ihre eigene Arbeit vorstellen und wie sie das JuPa organisieren möchten. Bei diesem Workshop durfte also von einer hohen Motivation der Teilnehmenden ausgegangen werden. Die 17 Jugendlichen waren mit dem Workshop sehr zufrieden. Ein Ergebnis war die Idee, die Arbeit des JuPas weiter zu öffnen und auch offenere Formate der Jugendbeteiligung zu unterstützen.
Workshopreihe „Aktivierende Jugendbeteiligung“
Ein zweitägiger und vier eintägige Workshops fanden in Kooperation mit der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl statt. Der zweitägige Workshop fand zusätzlich noch in Kooperation mit der Führungsakademie Baden-Württemberg statt. Alle fünf Workshops richteten sich an Mitarbeitende aus allen Verwaltungsbereichen wie z. B. Hauptämter, Jugendreferate, Fachstellen für Bürgerengagement usw.
Insbesondere standen folgende Fragen im Zentrum der Workshops:
- Wie können nachhaltige Strukturen der Jugendbeteiligung geschaffen werden?
- Womit sollten wir anfangen?
- Wie können wir möglichst viele Jugendliche erreichen?
- Was müssen wir auf dem Weg zu einem erfolgreichen Beteiligungsformat für Jugendliche beachten?
- Wie sorgen wir für eine Sicherung und Umsetzung von Ergebnissen?
- Wie können wir ein Jugendvertretungsorgan nachhaltig in die kommunale Verwaltungsstruktur einbinden?
Darüber hinaus vermittelten die Workshops einen Überblick über die verschiedenen Modelle der Jugendbeteiligung (Jugendforum, Jugendgemeinderat, Jugendbeirat usw.) und verdeutlichten, welches Modell unter welchen Gegebenheiten erfolgversprechend ist. Einen wichtigen Teil der Workshops stellte jeweils auch eine Vorstellung und Diskussion darüber, was die Änderungen der Gemeindeordnung für die Kommunen bedeuten.
Folgende Veranstaltungen fanden statt:
- 26.—27.10.2015: Zweitägiger Workshop in Stuttgart mit 9 Teilnehmenden
- 04.04.2016 in Bad Urach (Regierungsbezirk Tübingen) mit 20 Teilnehmenden
- 28.04.2016 in Rastatt (Regierungsbezirk Karlsruhe) mit 22 Teilnehmenden
- 03.05.2016 in Freiburg mit 24 Teilnehmenden
- 12.05.2016 in Stuttgart mit 25 Teilnehmenden
Alle vier Eintagesveranstaltunge folgten dem gleichen Konzept:
- Begrüßung, Kurzvorstellung des Projekts und seiner Träger sowie thematischer, raumsoziometrischer Einstieg
- „Alles neu?“ – Einige Grundlagen zur Jugendbeteiligung und zur neuen Gemeindeordnung
- „Das alles ist Jugendbeteiligung“ – Häufige Fragen und Beispiele guter Praxis
- Zeit für Ihre Rückfragen und Ergänzungen
- Formen der Jugendbeteiligung: „Was passt wann und wie setze ich es um?“
- Beratung von Umsetzungsideen in Gruppen
- Gesprächsrunde: „Was ist noch offen?“
Die Gliederung der zweitägigen Veranstaltung zeigt, wie sehr das Mehr an Zeit genutzt werden kann, um Wissen selbst zu erarbeiten, zu vertiefen und spielerisch auszutesten:
- Vorstellung des Projekts und seiner Träger, Erwartungsabfrage und raumsoziometrischer Einstieg in das Thema
- Rollenspiel: „Warum Jugendbeteiligung?“ (1. Gruppenaufgabe)
- Hintergründe, Ursachen und Ziele von Bürger- und Jugendbeteiligung
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten: Jugend- vs. Bürgerbeteiligung
- Erfolgsvoraussetzungen für Jugendbeteiligung (2. Gruppenaufgabe)
- Beteiligungsstufen und wichtige Beteiligungsinstrumente
- Welches Beteiligungsformat wähle ich unter welchen Umständen?
- Drei Fallbeispiele: „Wie würden Sie vorgehen?“ (3. Gruppenaufgabe)
- Projektmanagement und mehr: Zur Steuerung von Beteiligung
- Diskussion: „Wie erreichen wir Nachhaltigkeit in Prozess?“
- Ihre Wünsche: Zeit für Offenes und zu Vertiefendes
Bewusst waren beide Varianten des Angebots konzipiert worden, um einen Vergleich hinsichtlich Nachfrage und Lernerfolg zu bekommen. Sowohl die Referierenden als auch die Teilnehmenden fanden die möglichen Inhalte und Tiefe eines zweitägigen Workshop sehr viel besser und teilweise einen eintägigen Workshop explizit zu kurz. Gleichzeitig melden die Teilnehmenden des eintägigen Workshops mit großer Mehrheit zurück, dass sie an einem zweitägigen Angebot vermutlich nicht hätten teilnehmen können. Dies betrifft kleine und mittelgroße Kommunen wesentlich stärker als große. Die große Mehrzahl der Teilnehmenden kam jedoch aus kleinen bis sehr kleinen Kommunen. In diesen ist der Bedarf an kostengünstigen Weiterbildungen größer als in Kommunen, die sich jederzeit eine Kommunalberatung als Dienstleistung leisten können. Unabhängig von der Dauer der Veranstaltung war die Rückmeldungen auf alle fünf Veranstaltungen durchweg positiv bis sehr positiv. Insbesondere wurde das jeweilige Verhältnis von Inputs zu Erarbeitungen in der Gruppe sowie kollegialer Beratung in der Gruppe positiv hervorgehoben.
Jugendbeteiligung in Vereinen, Verbänden und Ringen
Ziel dieses Teilprojekts war die Erarbeitung eines Juleica-Bausteins zum Thema „Jugendbeteiligung in Vereinen und Verbänden“ sowie dessen Verschriftlichung in einer Arbeitshilfe. Diese wurde im Juli 2015 unter dem Titel „Selbstbestimmt! Beteiligung in der Jugendgruppe leben“ als Handreichung Nr. 3 veröffentlicht.
Die Juleica ist ein bundesweit anerkanntes Zertifikat für Jugendgruppenleiter*innen. Darüber hinaus besteht die Selbstverpflichtung von Vereinen und Verbänden in Baden-Württemberg, bei der Ausbildung der Jugendgruppenleiter*innen bestimmte Standards einzuhalten. U. a. ist geregelt, dass diese Ausbildung für die ehrenamtlichen Jugendgruppenleiter*innen mindestens 40 Einheiten à 40 Minuten enthält, was meistens einem einwöchigen Seminar entspricht. 22 dieser Einheiten sind fest gesetzt, z. B. durch rechtliche Grundlagen. 18 Einheiten aus drei unterschiedlichen Bausteinen können entlang eines vom Verband jeweils frei wählbaren Themas gestaltet werden.
Handreichung Nr. 3: „Selbstbestimmt! Beteiligung in der Jugendgruppe leben“
Die Handreichung folgt der unten skizzierten Logik des Workshopmoduls und ist als Methodensammlung mit ergänzenden Inhalten konzipiert. Sie beschäftigt sich mit Konzepten der Beteiligungsförderung auf fünf hierarchischen, jedoch miteinander verschränkten, Bezugsebenen:
- Persönliche und zwischenmenschliche Ebene (Kapitel „Beteiligung leben!“): Beteiligung ‒ was hat das mit mir zu tun? Was ist Beteiligung überhaupt? Welche Stufen der Beteiligung gibt es und wie finde ich meinen normativen Standpunkt, wie viel Beteiligung ich wann zulasse?
- Beteiligung in der Gruppe, gemeint sind überschaubare Gruppen, in denen jeder jeden kennt: Wie kommen wir in unserer Gruppe zu Entscheidungen, wie verhalten wir uns so, dass sich alle eingeladen fühlen, sich einzubringen? Wann sind Konsensentscheidungen sinnvoll und wie muss ich einen solchen Entscheidungsprozess moderieren, dass der Wunsch nach Konsens nicht zu einem Instrument der rhetorisch stärksten und ausdauerndsten wird?
- Beteiligung in Verbandsstrukturen, sprich: In Gruppen, in denen nicht mehr jeder jeden kennt und wo dennoch fortlaufend Entscheidungen zu treffen sind, die alle betreffen: Wie können wir hier zu Entscheidungen kommen? Wie können wir beispielsweise unsere Mitgliedsversammlungen so gestalten, dass sich alle eingeladen fühlen, mitzudiskutieren? Wie ist das Verhältnis von Jugend- und Erwachsenenverband?
- Beteiligung in der Kommune, hier geht es um den Transfer: Wie können wir als Jugendgruppe oder Verband uns in kommunale Themen einmischen und dort ggf. mit einer Stimme sprechen, die gehört wird? Wie gehen wir damit um, wenn wir nicht zu einer gemeinsamen Stimme finden? Wie können wir uns an bestehenden Beteiligungsprozessen beteiligen oder wie können wir Themen anstoßen und andere einladen, mitzudiskutieren?
Zu allen Kapiteln gibt es eine Einleitung mit mehreren Thesen und deren Diskussion. Darauf folgt jeweils ein Methodenteil mit der Beschreibung von Methoden, welche geeignet sind, die Inhalte der Thesen selbst erleben zu können bzw. anderen erlebbar zu machen. Zu jedem Kapitel gehören außerdem Methoden, die einen eher einführenden Charakter in das Thema haben sowie solche Methoden, die geeignet sind, weiterzudenken und Veränderungsprozesse in der Gruppe oder im Verband anzustoßen.
Die Handreichung kann im Onlineshop des Landesjugendrings heruntergeladen werden.
Workshopmodul und Arbeitsmaterialien „Selbstbestimmt! Beteiligung in der Jugendgruppe leben“
Das Modul wurde nach dem Baukastenprinzip gestaltet, um den Wünschen und Zielen der auftraggebenden Organisation entgegenzukommen. Variabel ist das Modul auch hinsichtlich der Länge: Es konnte ein kompletter Tag gebucht werden, z. B. als Juleica-Auffrischungsseminar, oder ein mehrstündiges Modul, welches als Baustein in die normale Juleica-Schulung integriert werden kann: von kurzen Einführungen zur Frage „Was heißt Beteiligung überhaupt und was heißt es, Beteiligung zu leben?“, bis hin zu Workshops mit dem Ziel, ein gemeinsames Vorgehen zur Öffnung hin zu mehr Beteiligung zu verabreden.
Seitens der Projektfachstelle wurde das Konzept schon vor Beginn des Entstehungsprozesses in den Vereinen, Verbänden und Ringen bekannt gemacht. Am Modul besonders interessierte Verbände und Ringe wurden mittels Leitfadeninterviews in die Konzeption eingebunden, in welchen deren Zugänge zum Thema, deren Bewertung und Bedeutungsbeimessung zu verschiedenen Themen und Herausforderungen sowie deren konkrete Wünsche an ein solches Modul abgefragt wurden. In die logistische Abwicklung der Aktionstage wurde die Akademie der Jugendarbeit eingebunden. Die Aufgaben lagen insbesondere in der Unterstützung bei der Bewerbung des Moduls sowie in den ersten Absprachen mit den nachfragenden Stellen zu Inhalten und Zielen, in der Vermittlung der Multis sowie in der Abrechnung. Die finalen inhaltlichen Absprachen mit den Multis blieben bei der Projektfachstelle.
Organisiert wurden im Rahmen des Projekts zwölf Veranstaltungen „Beteiligung in der Jugendgruppe leben“. Drei von diesen fielen, teils kurzfristig, aufgrund zu geringer Nachfrage aus. Auffällig hierbei war, dass insbesondere solche Veranstaltungen ausfielen, welche Ringe als Workshops frei angeboten und auf ihren normalen Wegen beworben hatten (Flyer, Homepage, …). In denjenigen Fällen, in denen das Modul fest in bestehende Juleica-Ausbildungen integriert wurde oder in denen Jugendverbände direkt nachgefragt und mit dem Tag ein konkretes Ziel verbunden hatten, fanden die Veranstaltungen statt:
- 10.04.2015: Integration eines dreieinhalbstündigen Beteiligungsmoduls in die gemeinsame Juleica-Ausbildung der Naturschutzjugend Baden-Württemberg und der BUND-Jugend Baden-Württemberg. 25 Teilnehmende.
- 25.04.2015: Integration eines dreieinhalbstündigen Beteiligungsmoduls in die Juleica-Ausbildung des Kreisjugendrings Ravensburg in Röthenbach im Allgäu.
- 05.06.2015: „Die Crux mit dem Konsens ‒ Wie wir zu Konsensentscheidungen kommen und wann Konsens eine Falle ist“ beim Jugendumweltfestival „Aufstand ‒ Wirtschafften das!“ der Naturschutzjugend Baden-Württemberg. Bei fünf Parallelworkshops nahmen 19 Jugendliche teil.
- 27.09.2015: „Beteiligung bei den Johannitern und mit den Johannitern“ ‒ Aktionstag im Landesverband Baden-Württemberg der Johanniter mit 17 Jugendlichen.
- 28.11.2015: „Beteiligung bei der DLRG-Jugend Baden“ ‒ 15 teilnehmende Landesvorstände und Gruppenleitungen.
- 29.11.2015: „Beteiligung in der Landjugend“ ‒ 19 jugendliche Vorstände des Bundesverbands der Landjugend beim Jahreskongress in Stuttgart, organisiert vom Landesverband Baden-Württemberg.
- 07.02.2016: „Beteiligung leben im Stadtjugendring Tübingen“ ‒ acht Jugendliche aus verschiedenen Verbänden des Stadtjugendrings Tübingen.
- 12.03.2016: „Beteiligung der Jugend im Schwarzwaldverein“ ‒ ganztägiger Workshop mit 45 Teilnehmenden.
- 23.04.2016: „Beteiligung erleben auf den Ferienfreizeiten im Jugendwerk der AWO Württemberg“ ‒ achtstündige Aktion mit insgesamt 50 Teilnehmenden.
Insbesondere die Vielseitigkeit der Einsatzmöglichkeiten war für die nachfragenden Stellen besonders positiv. Hervorzuheben ist zudem der Vorteil der Bewerbung des Moduls über die Homepage der Akademie der Jugendarbeit Baden-Württemberg: Die Tatsache, dass viele Vereine und Verbände ohnehin regelmäßig deren Angebot einsehen, kam der Anzahl der durchgeführten Workshops sehr zugute. Die Zielgruppen „Vereine, Verbände und Ringe“ wurden allesamt gut erreicht. Weniger gut abbdecken konnten sowohl LJR als auch die Akademie die für die Teilnahme bei freien Ausschreibungen wichtige Zielgruppe der Jugendlichen. Hier könnten Folgeprojekte jedoch Budget mit andenken, um für die Ringe auch Printmaterialien (Flyer…) zu erstellen, mit welchen diese dann gezielt Jugendliche ansprechen können, z. B. indem durch den Versand an ihre jeweiligen Mitgliedsverbände. Die Erfahrung zeigte, dass Jugendliche seltener in den Online-Angeboten der Ringe nach für sie spannenden Angeboten schauen: Sie fühlen sich ihrem eigenen Verband gegenüber verbunden, die Dachstruktur der Ringe ist für sie weiter entfernt von der eigenen Art, sich zu engagieren. Auch die Möglichkeit, Jugendliche über Social-Media-Angebote, wie Facebook, Twitter oder Snapchat zu erreichen sind für die Ringe oft begrenzt. Ideal wäre eine verstärkte Multiplikation der Veranstaltungen direkt über die Mitgliedsverbände. Diese sind aber stark von ehrenamtlichen Strukturen geprägt, weshalb solche „On-Top-Tätigkeiten“ häufig zu kurz kommen (müssen).
Potential könnte noch in der Titelgebung der Angebote stecken. „Beteiligung“ ist zunächst ein abstrakter Begriff. Unter Titeln, die die unbedingte Relevanz für die Jugendlichen direkt adressieren, können sich diese oft sehr viel mehr vorstellen. Beispiel: „Vom Umgang mit schwierigen Teilnehmenden“. Versucht wurde dies etwa im Workshop beim „Aufstand“ der Naturschutzjugend: „Die Crux mit dem Konsens“. Ein allgemeiner Beteiligungsworkshop hätte mit kreativ klingenden Angeboten wie „Aktivierung und Balance der Gehirnhälften durch Stockkamp“ oder „kreatives Prereycling mit Papier“ nicht konkurrieren können.
Jugendbeteiligung in der Schule
Handreichung Nr. 4: „Die Drittelparität in der Schulkonferenz. Erste Auswirkungen des neuen Schulgesetzes in Baden-Württemberg“
Im Bereich Schule befand sich vieles im Umbruch, besonders zu Beginn der zweiten Projektphase. Im Gegensatz zu den beiden o. g. Orten der Beteiligung erschien die Erarbeitung eines fertigen Moduls sowie einer Methoden- oder Ratgeberhandreichung zur Jugendbeteiligung in Schulen zum Zeitpunkt der Projektkonzeption als verfrüht; Die beteiligungskulturellen Auswirkungen der vielen gesetzlichen Änderungen waren nicht absehbar und hätten daher in einem solchen Konzept nicht berücksichtigt werden können. Hinzu kam, dass die für ein solches Modul notwendigen Vereinbarungen mit dem Kultusministerium in der Kürze der Projektlaufzeit nicht ausreichend detailliert hätten vorgenommen werden können.
Für die Arbeitsgruppe „Jugendbeteiligung in der Schule“ rückte daher eine Bestandsaufnahme der im August in Kraft getretenen gesetzlichen Änderungen und deren erste beobachtbaren Auswirkungen auf den Schulalltag in den Vordergrund. Der Fokus lag dabei auf der Einführung der drittelparitätischen Besetzung der Schulkonferenzen durch die Änderungen des § 47 Schulgesetz Baden-Württemberg. Grundlage der heuristisch angelegten Forschung waren Interviews mit Rektor*innen, mit Lehrer*innen sowie mit Schüler*innen, insbesondere solchen, die in der Schüler*innenmitverantwortung (SMV) ihrer Schule und/oder in entsprechenden Dachorganisationen aktiv sind. Der 36-seitige Abschlussbericht „Die Drittelparität in der Schulkonferenz. Erste Auswirkungen des neuen Schulgesetzes in Baden-Württemberg“ erschien im Herbst 2015 als Handreichung Nr. 4.
Die Handreichung kann im Onlineshop des Landesjugendrings heruntergeladen werden.
Workshopmodul „Sich engagieren und demokratische Teilhabe befördern durch gute Kommunikation in der SMV-Arbeit“
Auf Basis der im Abschlussbericht „Die Drittelparität in der Schulkonferenz“ formulierten Erkenntnisse konzipierte die in die Erstellung der Handreichung Nr. 4 eng eingebundene Multiplikatorin Vivianna Klarmann ein Sensibilisierungsmodul für Lehrer*innen (es wurden insbesondere die Vertrauenslehrer*innen angesprochen) sowie für Schüler*innen der SMV. Das Ziel des Moduls war es, die Beteiligungskultur zwischen Schüler*innen und Lehrer*innen zu fördern und aufzuzeigen, welche Möglichkeiten der Beteiligung und welche Wege der Umsetzung für die Beteiligung der Schüler*innen es im Schulalltag gibt. Ein besonderer Fokus lag auch auf der Frage der richtigen Kommunikation: Damit Schüler*innen etwas bewirken können, müssen sehr viele von ihnen am Meinungsbildungsprozess teilhaben. Die SMV muss durch einen Wahlprozess, der im Schulleben eine gewisse Bedeutung haben muss, ernannt werden. Nur so kann die SMV als legitime Vertreterin aller Schüler*innen mit weiteren Akteuren des Schullebens ins Gespräch treten und etwas bewirken. Zudem muss sich die SMV der Verantwortung eines solchen „Sprechens für alle“ bewusst sein. Es ist also wichtig, dass die SMV selbst zur breiten Beteiligung einlädt und diese vorlebt. Zugleich sollten Verbindungslehrerinnen und –lehrer darin sensibilisiert werden, welche Mittlerfunktion ihnen hierbei zukommen kann.
Das Modul „Sich engagieren und demokratische Teilhabe befördern durch gute Kommunikation in der SMV-Arbeit“ wurde so konzipiert, dass Lehrer*innen einer Schule nur dann an einer Sensibilisierungsveranstaltung teilnehmen können, wenn sich gleichzeitig Schüler*innen derselben Schule zur Teilnahme an derselben Veranstaltung anmelden. Damit wurde in der entsprechenden Schule der Wille zur Umsetzung der gemeinsam erarbeiteten Ideen gewährleistet. Pilotiert wurde das Modul am 02.12.2015 in Villingen-Schwenningen, im Rahmen einer jährlich stattfindenden, jeweils mehrtägigen Veranstaltungsreihe, welche das Regierungspräsidium Freiburg und die Außenstelle der LpB üblicherweise gemeinsam durchführen. Das Modul wurde, durch die Kooperation des Projekts mit der LpB, für die Gestaltung eines Tages – und damit eines wesentlichen Teils der Gesamtveranstaltung – gebucht. Das Modul gliederte sich in Freiburg in folgende Teile:
- Begrüßung und Vorstellung der Referierenden sowie der Baden-Württemberg Stiftung und des Projekts „In Zukunft mit UNS!“
- Raumsoziometrischer Einstieg und Übergang ins „Vier Ecken-Spiel“
- Was verstehen wir eigentlich unter Beteiligung und Demokratie?
- Stufen der Partizipation und unser Beteiligungsselbstverständnis
- World-Café: Beteiligungsmöglichkeiten in der SMV-Arbeit
- Grundlagen der Kommunikation
- Übung: Gestaltung von Gruppengesprächen und Kommunikation der SMV-Arbeit
Die sechs teilnehmenden Lehrer*innen sowie die 16 Schüler*innen kamen aus verschiedenen Gesamt- und berufsvorbereitenden Schulen im Regierungsbezirk Freiburg. Auffällig war, dass viele Schüler*innen motivierter erschienen, als ihre Lehrer*innen. Aufgrund der guten Zusammenarbeit wurde das Modul für eine zweite Veranstaltung im gleichen Kontext, jedoch mit Schüler*innen von Gymnasien angefragt. Diese Veranstaltung fiel allerdings wegen zu weniger Anmeldungen kurzfristig aus.
Regionale Vernetzungsveranstaltung „Jugendbeteiligung ist am Zug“
Am 12. Mai 2015 kamen Jugendliche, Jugendreferent*innen aus ganz Baden-Württemberg sowie Mitarbeitende aus Verwaltung und Politik zu einem Ideen- und Erfahrungsaustausch in St. Georgen im Schwarzwald zusammen. Eingeladen hatten das Projekt „In Zukunft mit UNS!“ sowie die Stadt St. Georgen und der Jugendgemeinderat St. Georgen. Die Vernetzungsveranstaltung bestand aus zwei Teilen: In den beiden in Karlsruhe und Konstanz fast zeitgleich gestarteten „Politikzügen“ gab es für die Teilnehmenden die Gelegenheit zum Kennenlernen, Austausch und zum Sammeln von Fragen und Anliegen. Das Angebot im Zug wurde von Multis des Projekts „In Zukunft mit UNS!“ moderiert. Beide Züge trafen zeitgleich in St. Georgen im Schwarzwald ein. Dort warteten zwei Shuttle-Busse, die die Teilnehmenden zum Hauptveranstaltungsort, in die Stadthalle St. Georgen, brachten.
Die Veranstaltung dort wurde moderiert vom Vorsitzenden des Jugendgemeinderats St. Georgen sowie der Vorsitzenden des Landesschülerbeirats Baden-Württemberg. In St. Georgen sah der Tagesablauf folgendermaßen aus:
- Begrüßungsgespräch zwischen dem Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung, dem Bürgermeister von St. Georgen sowie zwei Mitgliedern des Jugendgemeinderats St. Georgen
- Aktivierender, raumsoziometrischer Einstieg und Stationenaustausch: Was ist alles möglich in Sachen Jugendbeteiligung? Dazu Kurzpräsentationen einiger Beispiele
- Fünf parallel stattfindende Workshops, jeweils moderiert von Multis des Projekts:
- Stärkung der Beteiligungsrechte Jugendlicher: Was machen wir draus?
- Voneinander lernen: Was geht und was geht (noch) nicht in Sachen Jugendbeteiligung?
- Gesucht: Das Mobilitätskonzept der Zukunft
- Alles neu? Schullandschaft im Wandel
- Kollegialer Austausch für Jugendreferent*innen
- Und jetzt? Präsentation der Ergebnisse und Fishbowl-Diskussion zwischen Jugendlichen, Politiker*innen und Jugendreferent*innen.
Insgesamt waren 160 Teilnehmende vor Ort, wovon allerdings zwei Schulklassen aus St. Georgen nur bis zum von einer Schülerfirma bereiteten Mittagessen bleiben konnten. Am Nachmittag waren es knapp 90 Teilnehmende. Die Werbung zur Veranstaltung hatte sich somit gelohnt, war jedoch sehr ressourcenintensiv: Beteiligungsangebote von sämtlichen in der Nähe der Bahnstrecke liegenden Gemeinden sowie die Kontaktdaten zuständiger Personen wurden recherchiert, alle Personen wurden zunächst angeschrieben. Ein oder zwei weitere Anrufe waren in der Regel notwendig. Die Teilnehmenden kamen aus insgesamt 25 verschiedenen Gemeinden mit verschiedenen Jugendbeteiligungsmodellen.
Bilanzveranstaltung: Auch in Zukunft mit UNS!
Am 16.06.2016 fand im Stuttgarter Hospitalhof die Bilanzveranstaltung zum Projekt statt. Ziel der Veranstaltung war es, eine Bilanz zu ziehen und sich gegenseitig auszutauschen: Wer steht wo und wo steht das Land Baden-Württemberg insgesamt in Sachen Jugendbeteiligung. Zudem sollte ein Blick in die Zukunft gewagt werden: Was wünschen sich die Akteurinnen und Akteure und wer kann was dazu beitragen, diese Themen anzugehen? Eingeladen waren alle landesweit aktiven Akteur*innen der Jugendbeteiligung in Baden-Württemberg: Jugendliche, Vertretungen aus Politik und Verwaltung, Haupt- und Ehrenamtliche in Vereinen, Verbänden, Ringen, Kirchen und Bildungseinrichtungen.
Diesen Zielen näherten sich die Teilnehmenden in vier Etappen:
- In einem moderierten Begrüßungsgespräch tauschten sich Staatsrätin Gisela Erler, Christoph Dahl, Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung, sowie Vertreter*innen des Landesschülerbeirats, des Dachverbandes der Jugendgemeinderäte sowie des Projekts „In Zukunft mit UNS!“ aus. Die Gesprächsteilnehmenden resümierten aus ihrer jeweiligen Perspektive die Veränderungen im Feld der Jugendbeteiligung in den letzten Jahren, gaben einen Einblick in ihren persönlichen Alltag, berichteten über einprägsame Erfahrungen und formulierten Empfehlungen für das Gelingen von Jugendbeteiligungsverfahren.
- In einer ersten Runde von Themenworkshops am Vormittag tauschten sich die Teilnehmenden anhand zentraler Thesen über die wesentlichen Projekterfahrungen zu den Beteiligungsorten Schule, Politik, Kommune und Jugendgruppe aus und überlegten, welche wichtigen Themenfelder noch nicht bearbeitet werden.
- In der zweiten Runde der Themenworkshops richtete sich der Blick auf die Zukunft der Jugendbeteiligung in Baden-Württemberg: Entwickelt wurden Visionen, Ziele und Voraussetzungen einer gelingenden Jugendbeteiligung. Die erkenntnisleitenden Fragen wurden von den Teilnehmenden im Rahmen der ersten Themenworkshops entwickelt.
- In der Abschlussdiskussion wurden die zuvor entwickelten Forderungen und Ideen mit Praktiker*innen aus dem Feld diskutiert. Zudem wurden gemeinsame Botschaften und Ideen der Zusammenarbeit formuliert.
Insgesamt 65 Personen nahmen an der Veranstaltung teil. Die Teilnehmenden kamen überwiegend aus dem direkten Projektkontext, z. B. Mitglieder der Steuerungsgruppe oder mit dem Projekt in stetigem Austausch stehende Beteiligungsakteur*innen, wie z. B. LpB, Robert Bosch Stiftung etc. Teil des Veranstaltungskonzepts war es, den Tag so zu gestalten, dass auch möglichst viele weitere Akteur*innen der kommunalen Ebene sowie von Vereinen und Verbänden und insbesondere auch Jugendliche teilnehmen und die Projektbilanz sowie die sich ergebenden Forderungen mit dem „Blick von außen“ bereichern konnten. Solche projektexternen Akteurinnen und Akteure waren relativ wenige vor Ort. Für weitere Veranstaltungen dieser Art ist also noch erheblich mehr Zeit in die Werbung zu investieren. Sehr positiv hervorzuheben ist die Qualität der Ergebnisse der Bilanzveranstaltung: Alle Diskussionen in den Workshops erfolgten auf sehr hohem Niveau und waren getragen von einer konstruktiven Atmosphäre sowie einer fundierten Kenntnis der Situation in Baden-Württemberg und darüber hinaus.
Workshop „Wahl ab 16“
Aus den vielen Argumenten, die die Arbeitsgruppe zur Absenkung des Wahlalters für Landtagswahlen sammelte, lassen sich zwei hervorheben:
- Im Zuge des demographischen Wandels bekommen die Stimmen von Jugendlichen bei den meisten Themen ein immer geringeres Gewicht; die Wähler*innenschaft der über 60-jährigen nimmt zu, viele Parteien richten ihre Programme an den Älteren aus.
- Erfahrungen aus Bremen, Schleswig-Holstein und Österreich, wo sogar auf Bundesebene ab 16 gewählt wird, sowie von sämtlichen Kommunalwahlen ab 16 zeigen, dass Jugendliche in diesem Alter reif genug sind um verantwortlich zu wählen.
In den Augen der Workshopgruppe ist eine „Kampagne mit Bedacht“ das richtige Instrument, um den Erfolg sicherzustellen. Eine umfassende wissenschaftliche Begleitung einer solchen Kampagne sei unbedingt notwendig, um ihre Wirkung zu beurteilen – zu den letzten Kommunalwahlen gibt es kaum gesicherte Erkenntnisse über die Beteiligung Jugendlicher an der Wahl.
„Vision: Alle sozialen Milieus sind motiviert, informiert und aktiv!“
Oberste Priorität einer jeden Kampagne müsse sein, dass sie Jugendliche aller sozialen Milieus erreicht und darauf angelegt ist, diese mit dem Selbstbewusstsein und den Ressourcen auszustatten, ihre Anliegen neben dem Wahlakt auf vielfältige Weise in die Politik einzubringen. Milieus verstehen die Mitglieder der Arbeitsgruppe dabei im Sinne von „Lebenswirklichkeit“. So bilden Subkulturen oder unterschiedliche politische und lebensweltliche Einstellungen, z. B. durch die Prägung im Elternhaus, Milieus. Diese sind Teil einer vielfältigen Gesellschaft und müssen auf jeweils unterschiedlichem Wege erreicht werden, keinesfalls allein durch den Aufruf zur Teilnahme an der Wahl. Zur Unterstützung einer solchen milieusensiblen Jugendarbeit fordert die Arbeitsgruppe ausreichende und stabile finanzielle Mittel. Deren Vergabe soll berechenbar und rechtlich transparent erfolgen.
„Demokratiebildung muss Hand in Hand mit Jugendbeteiligung und Selbstorganisation von Jugendlichen gehen!“
Ab 16 wählen zu können, dürfe, so der Fazit, keinesfalls das Ende der Fahnenstange in der Weiterentwicklung der Demokratie sein. Jugendliche engagieren sich zunehmend vielfältig und tendenziell projektorientiert – und somit fernab einer parteipolitischen Bindung. Dieses multiple Engagement gelte es zu befördern. Zentral sei aber auch, dass Jugendliche verstehen, wie aus der Zivilgesellschaft kommende politische Forderungen in die formalisierte Politik und später in die Gesetzgebung eingehen, wie politische Kompromissfindung funktioniert und wie man in diesem Prozess seine Ziele weiterverfolgen kann. Neben der Gewährung von Rechten sei daher auch eine Strategie für eine umfassende Demokratiebildung nötig. Diese müsse Hand in Hand gehen mit weiteren Formen der Beteiligung Jugendlicher und der Möglichkeit, Selbstorganisation Jugendlicher zu befördern. Hierzu brauche es eine finanziell gut ausgestattete Assistenzstruktur, die auch über den Tellerrand formaler Politik hinausschaut, ein Mentor*innenkonzept, sowie rechtliche Absicherung und höhere Verbindlichkeit von über das Wahlrecht hinausgehenden Beteiligungsformaten auf Landesebene.
Workshop Jugendbeteiligung in der Jugendgruppe
Es ging um die Frage, was es braucht, damit Vereine und Verbände auch künftig auf Know-How zum Thema zurückgreifen und ihre eigene Jugendarbeit stärken können.
„Gelebte Beteiligung braucht Ressourcen.“
Für die Arbeitsgruppe „Beteiligung in der Jugendgruppe“ ist es wichtig, Jugendgruppen als Erfahrungsraum für Selbstbestimmung weiter zu stärken. Hierzu sei es notwendig, geeignete Methoden, positive Erfahrungen und Best Practice-Beispiele für die selbstorganisierte Jugendarbeit zu bündeln. Der Wissenstransfer unter den beteiligten Akteuren müsse sichergestellt werden. Hierbei könne eine landesweite Koordinierungsstelle mit geeigneten Schulungs- und Qualifizierungsangeboten unterstützend tätig werden. Zugleich können an einer solchen Stelle Erfahrungen darin gesammelt und weitergegeben werden, wie Verbände ihre eigene „Exklusivität“ aufbrechen und für Interessenten jenseits ihrer klassischen Zielgruppen interessant werden können. Thematisch wichtig sei es in der Qualifizierung insbesondere, die Selbstorganisation von Jugendvereinen und -verbänden in den Blick zu nehmen. Über Jahre gewachsene Hierarchien und Entscheidungsstrukturen sollten aktiv durch neue Mitglieder hinterfragt werden dürfen. Multiplikator*innenaus dem Projekt berichteten zudem, dass es kommunale Jugendringe es schwererer als Verbände hatten, Teilnehmende für die Angebote aus dem Projekt „In Zukunft mit UNS!“ zu begeistern. Verbände machten vom Angebot des Projekts direkt in ihren eigenen Strukturen Gebrauch und banden die Erkenntnisse in laufende Veränderungsprozesse oder in ihre Juleica-Schulung ein, diesen hands on-Vorteil haben Jugendringe weniger. Eine weitere Aufgabe einer Koordinierungsstelle könnte also darin liegen, die Ringe in der Öffentlichkeitsarbeit für solche Veranstaltungen zu unterstützen.
„Jugendbeteiligung braucht Jugendgruppen und -verbände als Beteiligungsexpertinnen!“
Notwendigkeit sei aber auch, eine gelebte Beteiligungskultur sicherzustellen – das kann eine Koordinierungsstelle nach Ansicht der Arbeitsgruppe nicht leisten. Dazu brauche es insbesondere hauptamtliche Fachkräfte, die planungssicher in der selbstorganisierten Jugendarbeit angestellt sind und wertvolle Unterstützungsarbeit für die ehrenamtlich Engagierten leisten. Zudem falle echte Selbstorganisation zunehmend schwerer, da Vereine und Verbände oft durch Wünsche und Forderungen von außen vereinnahmt werden. Dies sei zum Beispiel im Hinblick auf Kooperation Jugendarbeit und Schule zu betrachten, wenn Vereine Teile des Nachmittagsangebots an Schulen stellen. Es brauche also, so der Fazit, auch den expliziten politischen Willen, die Eigenständigkeit der selbstorganisierten Kinder- und Jugendarbeit zu bewahren und ihre Erfahrungen als Beteiligungsexpertin zu schätzen.
Jugendbeteiligung in der Kommune
„Damit kommunale Jugendbeteiligung selbstverständlich wird, braucht es Ressourcen, Strukturen, Haltungen und Inhalte!“ Die Teilnehmenden aus dem Workshop „Jugendbeteiligung in der Kommune“ wünschen sich noch mehr verbindliche Beteiligung sowie Strukturen, die zu einer Kultur der Beteiligung beitragen können. Hierzu fordern sie eine Koordinierungsstelle auf Landesebene. Diese soll:
- über Mittel zur Beteiligungsforschung verfügen und dabei insbesondere Voraussetzungen, Umsetzungsstrategien und Methoden der Beteiligung in Baden-Württemberg erheben und kommentieren,
- dieses Wissen verfügbar machen und Austauschplattformen sowie Fortbildungen für Jugendliche und für alle Akteure der Jugendarbeit auf kommunaler und landesweiter Ebene etablieren,
- als Beraterin von Kommunen sowie als Beraterin und Lobby der Jugendlichen wirken,
- die Umsetzung des § 41 a GemO überprüfen,
- als Ombudsstelle in Beteiligungsfragen wirken und im Streitfall Stellung beziehen und eine Einschätzung zur Situation geben können, wodurch ein vorschneller Gang an die Verwaltungsgerichte vermieden werden kann,
- als junge Menschen als Expert*innen im Themenfeld ausbilden, betreuen und an Kommunen zur Begleitung von Beteiligungsprozessen vermitteln.
Darüber hinaus fordert die Arbeitsgruppe, die Themen „Kommunalpolitik“ und „Beteiligung“ vermehrt in den Schulunterricht aufzunehmen, um Jugendliche fit für ihre Möglichkeiten zu machen. Die Förderung Jugendbeauftragter auf kommunaler Ebene ist eine weitere Forderung; hierfür müssen Jugendämter und Jugendpfleger*innen auch in kleinen Gemeinden über Ressourcen verfügen, damit sie Jugendbeteiligung als Querschnittsthema angehen können. Dies könne einerseits die Abstimmung mit den einzelnen Verwaltungsdezernaten der jeweiligen Kommune sicherstellen. Andererseits können damit Möglichkeiten eröffnet werden, weit über den häufig eng verstandenen Begriff der „Jugendhilfe“ hinaus Jugendliche in sie betreffende Themen und Anliegen einzubeziehen.
Jugendbeteiligung in der Schule
„Mehr Schülerinnen-Mitverwaltung wagen ‒ gelebte Beteiligung braucht mehr Raum im Schulalltag“
Von allen „Orten der Beteiligung“, mit denen sich das Projekt beschäftigte, sehen die Teilnehmenden eine Demokratisierung der Schule als schwierigste Aufgabe an. Zu wenig sei die Institution Schule von ihrem Wesen her demokratisch. Zum Einstieg warf die Workshop-Gruppe daher den Blick auf eine Neuerung letzten Jahre, die eine Verbesserung der Beteiligungsmöglichkeiten von Schüler*innen vorsieht: Die Aufnahme der sogenannten „Drittelparität“ in das Schulgesetz von Baden-Württemberg. Mit ihr soll künftig ein Drittel der Stimmen in der Schulkonferenz Schüler*innen gehören. Dies sei in der Tat ein großer Schritt mit viel Potential. Doch komme nach Ansicht der Gruppe die Änderung bisher nicht in der Beteiligungskultur der Schulen an. Die neuen Möglichkeiten würden nicht von den Schulen im Sinne einer Ermutigung beworben, sich jetzt erst recht in der Schüler*innenmitverantwortung (SMV) zu engagieren. Auch würden Schüler*innen nicht sonderlich oft in einer Weise auf diese Beteiligungsmöglichkeit zurückgreifen, dass sie über die Erfüllung der Drittelparität in der Schulkonferenz hinaus auf eine demokratischere Schulkultur wirken könnte. Hier fehle die Vision und das Vertrauen, nachhaltige Antworten auf die Frage zu finden: „Was können wir Schülerinnnen und Schüler schon groß ändern?“
Grundsätzlich sieht die Gruppe vielfältige Ursachen für den nicht besonders ausgeprägten Beteiligungsenthusiasmus: Volle Lehrpläne, welche aufgrund von zentralisierten Prüfungen und G8 kaum kreative Auslegungen zuließen, die stattfindende „Überschwemmung“ von Schulen mit Bitten um Kooperationen und Mitwirkung sowie stark gestiegene zeitliche Belastungen der Lehrenden seien nur einige von ihnen. Die Gruppe wünscht sich, dass „Soft Skills“, wie eine Sensibilität für Beteiligungsfragen, schon in der Lehramtsausbildung einen festen Platz haben sollen. Nicht als Schulfach, sondern als Wert. Beteiligung sei eine Kultur, die Kindern und Jugendlichen vorgelebt werden soll, die sich nicht dozieren lässt, sondern eine Grundhaltung ist. Dafür brauche es allerdings auch Erfahrungswerte und die richtigen Methoden. Hierzu empfiehlt die Arbeitsgruppe einen dauerhaften und leicht zugänglichen „Markt der Möglichkeiten“ sowie motivierende Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer. Vor allem müsse durch positive Erfahrungen die Angst genommen werden, bei der Gewährung von Mitbestimmung oder einer breiten Beteiligung die Kontrolle über die Klasse zu verlieren.
Weiter empfiehlt die Arbeitsgruppe, dass entweder die Vertrauenslehrer*innenfür Beteiligungsfragen fortgebildet werden sollen oder dass eigene Ansprechpartner*innen für Beteiligungsfragen benannt und entsprechend auf ihre Aufgabe vorbereitet werden sollen.
Vernetzung von Aktiven der Jugendbeteiligung
Wie kann eine Vernetzung aller relevanten Akteure auch unabhängig von einem einzelnen Projekt dauerhaft gestärkt werden? In allen Phasen des Projekts hat die Projektstelle „In Zukunft mit UNS!“ die Erfahrung gemacht, dass es ein Team von fest eingebundenen Multiplikator*innen braucht, um möglichst viele Jugendliche aus verschiedenen Jugendkulturen zu erreichen. Zudem müssen Plattformen geschaffen werden, um den Austausch zwischen Jugendvertretungen und den Verantwortungsträger*innn aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft anzuregen und stabile Netzwerke zu etablieren. Deshalb war es der Projektstelle ein zentrales Anliegen, Jugendliche und junge Erwachsene als Multiplikator*innen zu qualifizieren und einzubinden und im Rahmen von dialogorientierten Veranstaltungen Gelegenheit zur Vernetzung auf allen Ebenen zu geben.
„Es braucht Ansprechpersonen zum Thema Jugendbeteiligung auf kommunaler Ebene in Verwaltung und Schule.“
Ziel jeglicher Vernetzungsaktivitäten ist es nach Ansicht der Gruppe, einen umfassenden Wissenstransfer zu ermöglichen und stabil im Fluss zu halten. Gute Ideen und Umsetzungsbeispiele zum Thema „Beteiligung“ mit unterschiedlichen Zielgruppen gebe es an vielen Stellen im Land. Oft seien diese beispielhaften Beteiligungsstrukturen jedoch vom Engagement einzelner Personen abhängig. Die Gruppe bekräftigte deshalb die Forderung, eine landesweite Koordinierungsstelle einzurichten. Diese solle umfangreiche Funktionen erfüllen:
- Aufbau und Unterhalt einer „Multiplikator*innen-Akademie“ und Vermittlung von Multiplikator*innen,
- Einrichtung einer zentralen Datenbank auf Landesebene,
- Durchführung von Informationskampagnen und Qualifizierungsmaßnahmen für Jugendliche, Politiker und Angestellte der Verwaltungen,
- eine niedrigschwellige Kommunikation auf Augenhöhe aller Beteiligten sicherstellen,
- Vernetzungstreffen auf regionaler und landesweiter Ebene organisieren und durchführen; hierbei sei insbesondere zu Beginn mit verschiedenen Ausrichtungen, Formaten und Methoden zu experimentieren um ein für alle attraktives Angebot zu schaffen.
Neben der landesweiten Koordination fordert die Arbeitsgruppe zudem Koordinierungsstellen oder zumindest feste Ansprechpersonen in den kommunalen Ringen oder den Jugendreferaten in den Kreisen, Städten und Gemeinden Baden-Württemberg: Diese sollen mit den Kenntnissen der Angebote und Akteure vor Ort in der Lage sein, die unterschiedlichen Beteiligungsorte und -Zielgruppen zusammen zu bringen und mit der landesweiten Koordination Hand in Hand arbeiten.
Abschlussdiskussion
Die Diskussionsergebnisse und Projekterfahrungen können auf fünf Empfehlungen für eine gelingende Jugendbeteiligung in Schulen, Verbänden und Kommunen zugespitzt werden:
- Jugendbeteiligung ist mehr als Wählen. Jugendliche können an vielen Orten ihres Lebensumfeldes (Schule, Kommune, persönliches Umfeld) positive Beteiligungserfahrungen machen. Deshalb ist Jugendbeteiligung eine gesellschaftliche Zukunftsaufgabe, die über Institutionen hinweg gedacht und im Alltag verankert werden muss.
- Jugendliche sollten schon früh in ihrem persönlichen Lebensumfeld positive Partizipationserfahrungen machen und mit der Übernahme von Verantwortung experimentieren können. Der nicht-schulische und nicht-formalpolitische Rahmen von Vereinen und Verbänden ist hierfür bestens geeignet.
- Jede Kommune sollte ihren eigenen, passgenauen Ansatz für Jugendbeteiligung finden. Über stabile Landesprogramme und eine landesweite Koordinierungsstelle für Jugendbeteiligung können Ideen, Informationen und Strategien in die Kommunen transferiert werden.
- Um Jugendbeteiligung zu stärken, ist es notwendig, dass die einzelnen Akteure wie Schulen, Jugendverbände, Jugendringe, Kommunen und die Jugendsozialarbeit eng zusammenarbeiten und ihre Kräfte bündeln. Stabile Netzwerke, gut qualifizierte und engagierte Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie eine Kultur des Gehörtwerdens sind zentrale Voraussetzungen für das Gelingen von Beteiligungsverfahren.
- Zukünftige Initiativen zur Jugendbeteiligung müssen sowohl bereits motivierte Jugendliche erreichen, als auch stille Gruppen berücksichtigen. Hierzu ist es notwendig, die Akteur*innen und Erfahrungen der Jugendsozialarbeit und der mobilen Jugendarbeit (Streetworker*innen) verstärkt einzubeziehen.
Fazit
Zusammenfassend können aus dem Projekt zentralen Empfehlungen für eine gute Zukunft der Jugendbeteiligung ausgesprochen werden:
- Jugendbeteiligung ist mehr als Wählen. Jugendliche können an vielen Orten ihres Lebensumfeldes, Schule, Kommune, persönliches Umfeld, positive Beteiligungserfahrungen machen. Deshalb ist Jugendbeteiligung eine gesellschaftliche Zukunftsaufgabe, die über Institutionen hinweg gedacht und fest im Alltag der jungen Menschen verankert werden muss.
- Jugendliche sollten schon früh in ihrem persönlichen Lebensumfeld positive Partizipationserfahrungen machen und mit der Übernahme von Verantwortung experimentieren können. Der nicht-schulische und nicht-formalpolitische Rahmen von Vereinen und Verbänden ist hierfür bestens geeignet.
- Jede Kommune sollte ihren eigenen, passgenauen Ansatz für Jugendbeteiligung finden. Über stabile Landesprogramme und eine landesweite Koordinierungsstelle für Jugendbeteiligung können Ideen, Informationen und Strategien in die Kommunen transferiert werden.
- Um Jugendbeteiligung zu stärken ist es notwendig, dass Schulen, Jugendverbände, Jugendringe, Kommunen, zivilgesellschaftliche Organisationen und die Jugendsozialarbeit eng zusammenarbeiten und Kräfte bündeln. Ein stabiles Netzwerke, gut qualifizierte und engagierte Multiplikator*innen sowie eine Kultur des Gehörtwerdens sind zentrale Voraussetzungen für das Gelingen von Beteiligungsverfahren.
- Zukünftige Initiativen zur Jugendbeteiligung müssen sowohl bereits motivierte Jugendliche erreichen, als auch „stille Gruppen“ berücksichtigen. Hierzu ist es notwendig, die Akteurinnen und Akteure der Jugendsozialarbeit und der mobilen Jugendarbeit (z. B. Streetworker*innen) und deren Erfahrungen verstärkt einzubeziehen.